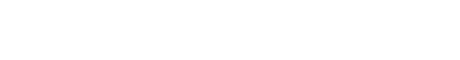2008 Carl August Zehnder

Geboren am 5. Oktober 1937 und aufgewachsen in Baden. Studium der Mathematik an der ETH Zürich, 1965 Dr. sc. math. (Professoren E. Stiefel und H. Künzi). 1965 Industrieberatung, 1966¬1967 Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute of Technology (MIT). 1967 stellvertreten¬der Leiter des neu gegründeten Instituts für Operations Research an der ETH Zürich, 1970 Assis¬tenzprofessor für Computerwissenschaften, 1973 ausserordentlicher, 1979 ordentlicher Professor für Informatik. Baut das Forschungsgebiet «Datenbanken» auf. Zur Tätigkeit in Lehre und Forschung kamen immer wieder Zusatzaufgaben für die ETH Zürich, (u.a. 1987-1990 Vizepräsident der ETH Zürich für den Bereich Dienste, 1991-1997 Vorsteher des Departements Informatik) sowie als Oberst i Gst in der Armee. Langjähriger Präsident von Informatik-Fachverbänden, so SVI/FSI, seit 2004 ICTswitzerland —Schweiz. Verband der Informatikorganisationen / Fédération suisse des organisations d'informatique, dann auch SARIT - Swiss Association for Research in Information Technology.
In Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes für den Aufbau der akademischen Informatik in der Schweiz, in Würdigung seiner bildungs-politischen Anstrengungen, die Informatik der Schweizer Jugend näher zu bringen, sowie für seinen Beitrag zum besseren Verständnis für die Informatik und ihre Anwendungen in Gesellschaft und Politik.
Laudatio
Fulvio Caccia
Carl August Zehnder, 1937 in Baden im Aargau geboren, stammt aus einem konservativen, strebsamen Elternhaus. Sein Grossvater väterlicherseits war noch Bauer im Nachbardorf Birmenstorf, sein Vater Zeit seines Lebens Kaufmann und Prokurist in einem grösseren Textilgeschäft in Baden. Zu Hause prägend waren aber namentlich auch die Grosseltern mütterlicherseits, die sehr auf Lerneifer und Disziplin pochten. Er wuchs lange als Einzelkind auf; seine beiden Brüder sind sieben und zehn Jahre jünger als er.
Die Schule erlebte er positiv, da ihm das Lernen leicht fiel. Bei Jungwacht und Kadetten (letztere damals obligatorisch im Aargau) knüpfte er viele Kontakte und wurde später auch mit Führungsaufgaben betraut. Aus der Bezirksschulzeit stammen noch heute seine wichtigsten persönlichen Freundschaften.
Ausbildung
Dass er ins Gymnasium gehen würde, war bei seinen guten Schulnoten schon früh klar. Nach Primar- und Bezirksschule in Baden musste er dazu nach Aarau wechseln (damals einzige Kantonsschule im Aargau), wo er das Gymnasium Typ A besuchte (im Griechisch mit nur vier Schülern bei einem sehr strengen Lehrer). In dieser Zeit erwachte sein Interesse an Politik. Er sorgte dafür, dass im Lesezimmer mehr Tageszeitungen verfügbar wurden und war Mitgründer einer Jugendgruppe der Neuen Helvetischen Gesellschaft. Die Studienwahl nach der Matur war rasch klar: Mathematik (mit dem Berufsziel Mittelschullehrer), auch die Wahl der Hochschule, die ETH in Zürich (weil sie gegenüber der Uni einen rascheren Abschluss in Aussicht stellte). Das Studium war streng, nicht zuletzt weil er parallel dazu seinen Militärdienst leistete, der fast alle grossen Ferien und viele Randwochen der Studiensemester auffrass. Aber trotzdem blieb ihm Zeit, um ab dem 5. Semester als Hilfslehrer in Zürcher Mittelschulen tätig zu werden: was er gerne tat: es sicherte ihm erste Erfahrungen als Lehrer und erst noch ein sehr willkommenes erstes Einkommen.
Angewandte Mathematik und Operations Research
Eher zufällig hatte ihn schon im 3. Semester (1958) ein Studienkollege auf eine Wahlvorlesung «Programmieren» von Prof. Heinz Rutishauser aufmerksam gemacht, wo er hinging — und blieb. Auf diese Weise kam er früh an Rechenautomaten (wie die Computer damals an der ETH genannt wurden) heran und lernte programmieren (ERMETH-Maschinensprache und später Algol). Schon vor dem Diplomabschluss fragte ihn der damalige Direktor der Instituts für Angewandte Mathematik, Prof. Eduard Stiefel, ob er Assistent werden möchte, was er gerne bejahte. Anfänglich war er dann Rutishausers Assistent, dann erhielt er selbständige Aufgaben, 1963 für das Militär (siehe unten), 1964 für das ETH-Rektorat (Prüfungspläne), woraus dann auch seine Dissertation entstand. Sie behandelte die «automatische Berechnung von Stunden- und Transportplänen». Da diese Probleme eher zum Bereich des Operations-Research (OR) zählten, wurde Hans Künzi, OR-Professor an der Universität Zürich, zu seinem eigentlichen Doktorvater.
Militär
1957 rückte Carl. A. Zehnder in die Rekruten-schule nach Yverdon ein, mit dem Ziel, Panzerabwehrkanonier zu werden. Als Mathematikstudent war er in dieser Umgebung eher ein Sonderfall, erhielt daher schon rasch Sonderaufgaben im Büro, später problemlos den Vorschlag für Korporal und darauf für Leutnant. Viele Dienste folgten, meistens wieder in der Westschweiz.
Dann erfolgt 1963 eine interessante Weichen-stellung in Zürich. Prof. Stiefel (selber Oberst beim Artilleriewetterdienst) fragte ihn, ob er — damals Panzerabwehr-Leutnant — interessiert daran wäre, bei einem grösseren Projekt für die Armee-Planung mitzumachen, bei der es um die Simulation von Panzergefechten ging; die Schweizer Armee stand vor einer Evaluation neuer Panzertypen. Er war interessiert und konnte darauf vollzeitlich ein Jahr lang ein computergestütztes Simulationssystem planen; für die Realisierung stand ihm ein Grossteil der Mitarbeiter im Institut Stiefel zur Verfügung, die ihre WK-Wochen so im Büro abdienen konnten (was sie gerne taten).
Für ihn begann damit eine neue Rolle als Vater des Panzersimulationsmodells «Kompass»: sie liess ihn anschliessend fast zwei Jahrzehnte nicht mehr los — nebenamtlich natürlich.
Als Kompass-Projektleiter wurde er immer wieder in militärische Planungsgremien in Bern einbezogen, weshalb ihm der damalige Oberstleutnant (und spätere Generalstabschef) Hans Senn empfahl, sich zum Generalstabsoffizier ausbilden zu lassen (als Milizler selbstverständlich), da «nur so Ihre mathematischen Arbeiten in Bern auch Gehör finden». Da aber damals die Teilnahme an Generalstabskursen strikte auf Kommandanten beschränkt war, bedeutete dies für ihn vollen «grünen» Militärdienst mindestens bis zum Bataillonskommando. Er sagte ja dazu, ins-besondere deswegen, weil ihn die Managementausbildung reizte, die offenbar mit der Generalstabsausbildung verbunden sein würde. Er wurde in diesem Punkt nicht enttäuscht.
Bis 1978 war er somit militärisch immer im Doppeleinsatz, einerseits «grün» (Kdt Pzaw Kp 24, Kdt PAL Kp 44, Gst Of Stab Gz Div 5, Kdt Füs Bat 102), anderseits als Begleiter von «Kompass» (am Schluss selber als Doktorvater eines weiteren «Kompass-Assistenten»). Ab 1979 konnte er dann den «grünen» und den Informatik-Teil seiner Militärtätigkeit kombinieren. Er wurde in verschiedenen Funktionen im Armeestab eingesetzt, am Schluss als Chef Informatik bei Divisionär Gustav Däniker, dem Stabschef Operative Schulung, wo er in den grossen Gesamtverteidigungsübungen 1984 und 1988 die Informatikdienste im Vorzimmer des verbunkerten Bundesrats vorbereiten und überprüfen konnte.
Die Schlussphase seines Militärdienstes wurde dann allerdings ein Trauerspiel. Für die Armee 95 mit ihren grossen Umstellungen musste der sog. Generalstabsbehelf (die umfassende Armeedokumentation) von Loseblätter-Ordnern auf eine Informatiklösung mit CD-ROM umgestellt wer¬den. Diese CD-ROM wurde durch zwei seiner ehemaligen Doktoranden technisch hervorragend entwickelt; er selber begleitete die Einführung. Leider gab es später ein Sicherheitsproblem (der «Fall Nyffenegger»), das wegen einer Überreaktion der damaligen Bundesanwältin beinahe zur Staatskrise eskalierte und völlig unnötige Ver-fahren auslöste, die seine beiden ehemaligen Doktoranden stark belasteten.
Erste Schritte in der Hochschulverwaltung
Auch aus seinem nächsten Tätigkeitsbereich im Institut Stiefel entwickelte sich eine lange Kette von neuen Aufgaben. Die ETH Zürich hatte im Frühling 1964 erstmal einen industriell gefertigten Computer erhalten (die CDC 1604-A). Diese Maschine konnte — im Gegensatz zur ERMETH, die nur Ziffern kannte und daher nur mit Zahlen rechnen konnte — auch Buchstaben und damit Wörter verarbeiten. Und weil im gleichen Jahr der damalige Dienstchef im Rektorat, der vorher halbjährlich die ETH-Prüfungspläne aufstellte, pensioniert wurde, fragte der damalige Rektor Traupel seinen Kollegen Stiefel, ob allenfalls sein neuer Computer diese Funktion übernehmen könnte. Stiefel gab die Aufgabe an Zehnder weiter, womit dessen langjährige Tätigkeiten für das Rektorat und die ganze Hochschulverwaltung begannen.
Die Termine waren gegeben. 1964 konnte er im Herbst die einfachere Hälfte der Prüfungspläne automatisch produzieren, im Frühling 1965 auch den Rest. Da er nachher nach Amerika gehen wollte, galt es für die Weiterbetreuung dieser Aufgabe einen geeigneten Mann zu finden; es war der Maschineningenieur Robert Nussbaum (später sein erster Doktorand).
Zehnder verreiste mit seiner Frau im März 1966 nach Boston ans MIT. Er hatte dazu ein Nachwuchsstipendium des Schweizerischen Nationalfonds erhalten und konnte daher in Amerika Verschiedenstes tun. So ergänzte er ein Buchmanuskripts von Hans Künzi und Hans Tzschach über «Mathematische Optimierung» um ein verbindendes Zwischenkapitel; dazu kamen Besuche bei militärischen US-Forschungsinstituten zum Thema Panzer-Gefechts-Simulation und die Entwicklung eines Fahrplan-Simulationsprogramms für Güterzüge für die echte «Santa Fe»-Eisenbahn-gesellschaft.
Doch schon nach einem Jahr erhielt er die An-frage von Prof. Franz Weinberg von der ETH Zürich, ob er als sein «Vize» in das eben gegründete «Institut für Operations Research IFOR» zurück nach Zürich kommen möchte. Er wollte. — In Zürich begann so 1967 seine langjährige Doppelrolle an der ETH als Wissenschafter einerseits und als Verwaltungsmann anderseits.
Wissenschaft
1967 war Datenverarbeitung als Wissenschaft noch undenkbar. Computernahe Wissenschafts-bereiche hiessen damals angewandte Mathematik, Wissenschaftliches Rechnen, Theorie der Programmierung, Operations Research und natürlich auch Elektrotechnik. Zehnder erhielt 1967 Lehraufträge für Nichtlineare Optimierung, bald auch für Programmieren, und er wurde daher 1970, zusätzlich zu seinen administrativen Aufgaben, zum Assistenzprofessor für Computerwissenschaften gewählt ((Informatik> erscheint an der ETH als Begriff erst 1974). Seither konzentrierte sich seine wissenschaftliche Tätigkeit auf Datenbanken. Er baute diesen Bereich an der ETH auf und weitete ihn später aus (nach seiner Funktion in der Schulleitung, also ab 1990) zu «grossen Informationssystemen».
Produkte aus dieser Tätigkeit waren z.B. ein allgemeines und einfaches Datenbank-Entwurfsmodell (Entitäten-Block-Diagramm) sowie das Datenbanksystem LIDAS für Niklaus Wirths Lilith-Computer. Zu nennen ist auch das Lehrbuch «Informationssysteme und Datenbanken», das inzwischen in der 8. Auflage erschienen ist.
Aus seinem Assistentenkreis habe ich auch etwas Anekdotisches aus dieser Zeit erfahren. — Gustis Schreibtisch, ja sein ganzes Büro waren immer voll gestapelt mit Dokumenten, Büchern etc. Oft konnte er kein A4-Blatt mehr auf seinen Schreibtisch legen. Aber er hat immer alles sofort gefunden. Sein Gedächtnis, welches Papier wo lag, ist phenomenal. — Gusti pflegte die Übungsaufgaben für seine Studierenden immer einer eigenen Schlusskontrolle zu unterziehen. Seine Assistenten konnten sehr selbständig arbeiten — aber Kontrolle musste sein. Nun konnte es schon auch vorkommen, dass ein Dokument aus seinem Blickwinkel verschwand und damit seiner Aufmerksamkeit entging. Die Korrekturen an den Übungsaufgaben kamen zwar immer, freilich zuweilen auch später, Tage nachdem die Übung stattgefunden hatte. Aber eben: seine Assistenten waren selbständig.
Neben dem erwähnten wissenschaftlichen Kerngebiet betreute Carl A. Zehnder an der ETH zwei weitere Themen langjährig. Ab 1977 bis zu seiner Emeritierung hielt er eine Vorlesung «Informatik-Projektführung», in der die Studierenden des 5. Semesters eine Methodik kennenlernten, die ihnen schon im Studium bei ihren selbständigen Arbeiten, später aber auch in der Praxis helfen konnte. Auch hierzu entwickelte er ein Lehrbuch («Informatik-Projektentwicklung», 4. Auflage). Und schon ab Sommersemester 1973 hielt er mit drei Kollegen (den Juristen Peter Forstmoser und Beat Lehmann sowie Kurt Bauknecht, Informations- und Kommunikationsmanagement) während dreissig Jahren jedes Sommersemester ein Seminar über «Informatik und Recht», an welchem Studierende aus Informatik und Recht beider Zürcher Hochschulen teilnehmen konnten. In der kleinen Schweiz wurde man rasch auf dieses Seminar aufmerksam; Bundesrat Kurt Furgler holte 1978 alle vier Dozenten in die Expertenkommission für das künftige Datenschutzgesetz.
Verwaltung
Carl A. Zehnder kam ganz offensichtlich zur richtigen Zeit im richtigen Alter in die Hochschulinformatik. In den 60er Jahren wurde es technisch erstmals möglich, grössere administrative Aufgaben mit dem neuen Instrument zu lösen oder zu unterstützen. An der ETH kamen nach den Prüfungsplänen immer neue Anwendungen dazu: Semesterprogramm, Studentenverzeichnisse, Telefonbuch. Daher beauftragte der damalige Präsident der ETH Zürich, Hans Hauri, Zehnder Anfang 1969 mit dem Aufbau einer sog. «Koordinationsgruppe für Datenverarbeitung» (KDV), worin die Benutzerbetreuung für den künftigen Grossrechner CDC 6000 und die sukzessiv wachsende Verwaltungsinformatik beim Rektorat zusammengefasst wurden. Bereits nach vier Jahren waren diese Aufgaben so wichtig geworden, dass Zehnder 1973 vom damaligen Rektor Heinrich Zollinger als «Delegierter für Studienorganisation» (heute «Prorektor») berufen wurde, gleichzeitig mit der Beförderung zum ausserordentlichen Professor. Warum Zehnder? Es war damals schlicht kein anderer Professor da, der über genügenden Einblick in Verwaltungsfragen und zugleich Informatik verfügt hätte.
In dieser Phase setzte Zehnders Tätigkeit auch für andere Hochschulen, vor allem in der Schweiz, ein. Er war von Beginn an Mitglied der sog. CICUS (Commission d'informatique de la Conférence universitaire suisse) und vertrat dort die ETH Zürich und zeitweise gleichzeitig auch den ETH-Rat. Aus dieser Funktion heraus entwickelte sich auch sein Einsatz für das Schweizerische Hochschulinformationsystem (SHIS). Dieses erlaubt seit 1972 eine systematische statistische Erfassung aller Hochschul-Studierenden in der Schweiz dadurch, dass alle Hochschulen einmal pro Semester ihre Daten an eine Zentrale liefern, identifiziert mit einer damals eingeführten schweizerischen Studenten-Matrikel-Nummer. Dieses zentrale Datensystem entstand und lief darauf 15 Jahre an der ETH Zürich, bis endlich das Bundesamt für Statistik diese Aufgabe übernehmen konnte. Die Arbeit in der CICUS führte Zehnder auch zu vielen Beratungs- und Überprüfungsaufgaben für andere Hochschulen. An der ETH selber bildeten die 70er Jahre den Hintergrund für eine weitere wichtige Entwicklung. Von 1970 bis 1981 dauerte der Kampf der kleinen Gruppe von vier Informatikprofessoren für den Aufbau eines eigenen Diplomstudiums in Informatik. Erst 1981 kam es dann endlich — es brauchte damals einen Beschluss des Bundesrats — zur Gründung der neuen «Abteilung IIIC für Informatik», die erste Neugründung nach der Errichtung der Abteilung für Elektrotechnik IIIB ein halbes Jahrhundert zuvor. Zehnder war 1979 Ordinarius geworden und wurde 1981 zum ersten Abteilungsvorstand (heute Departementsvorsteher) für Informatik gewählt.
Für die Jahre 1987-1990 fiel ihm eine noch grössere anspruchsvolle Verwaltungsaufgabe zu; der neue Präsident, Hans Bühlmann, holte ihn 1987 als Vizepräsident «Dienste» (heute «Infrastruktur und Finanzen») in seine Schulleitung. — Es war eine spannende, aber auch aufreibende Zeit, die z.B. auch den Aufbau des Supercomputer-Rechenzentrums CSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico) in Manno TI umfasste (bei diesem Projekt habe ich ihn persönlich kennen gelernt). Die Informatikentwicklung war damals auch quantitativ dramatisch. An der ETH Zürich gab es 1987 total etwas mehr als 1000 Computer, ab 1988 kamen pro Jahr über 1000 dazu (auf Grund eines grossen Informatik-Förderungsprogramms des Bundes, an dessen Schaffung auch Zehnder beteiligt war).
Verbände
Schon 1963 gewann ihn sein Doktorvater Hans Künzi für den Vorstand der noch jungen Schweizerischen Vereinigung für Operations Research (Zehnder wurde später deren Kassier). Seither hat Zehnder in Informatikverbänden aller Art so viele Aufgaben aller Art wahrgenommen, dass eine vollständige Aufzählung hier keinen Platz findet. Deren drei sollen aber erwähnt werden.
Ab 1970 gab es Anstrengungen, die überall aufkeimenden Informatik-Grüppchen und Kleinvereine in der Schweiz besser zu koordinieren. Nach vielen Verhandlungen entstand daraus 1980 der Dachverband «Schweizerischer Verband der Informatikorganisationen» SVI/FSI. Zehnder wurde Gründungspräsident und musste die Verbandsleitung auch später noch zweimal übernehmen, bis sie 2004 an die Nachfolgeorganisation ICTswitzerland weitergegeben werden konnte. Ein grosses Problem auf dieser Stufe der Verbandsführung liegt darin, dass nur relativ wenige Personen genügend breit tätig, bekannt und gleichzeitig bereit sind, ihre knappe Zeit dafür einzusetzen. Dann zur Berufsbildung: Interessanterweise ergriffen schon 1974 die drei grossen schweizerischen Organisationen Arbeitgeberverband, Bürofachverband (heute Swico) und Kaufmännischer Verband die Initiative für höhere Berufsprüfungen in Informatik; einen Partnerverband in der Informatik gab es damals noch nicht. Da der Bund zu dieser Zeit jedoch Impulsprogramme zur Förderung der Informatik schuf und Zehnder auf Wunsch von Waldemar Jucker das Programm für neue Wirtschaftsinformatikschulen entwerfen sollte, kam er bald in nahen Kontakt zu dem Triumvirat, das die oben genannten Verbände führte (Heinz Allenspach, gefolgt von Peter Hasler; Kurt Müller; Eduard Ruchti), so dass er anfänglich persönlich und später als Vertreter der Informatikverbände in verschiedenen Gremien anerkannt wurde.
Die Swiss Association for Research in Information Technology SARIT ging 1997 aus einer kleinen Vorgängerorganisation hervor. Diese hatte seit 1988 Schweizer ans Forschungszentrum ICSI in Berkeley CA entsandt; 1996 gingen ihr recht plötzlich die früher verfügbaren grossen Bundesmittel aus. Zehnder übernahm daher das Präsidium der neuen SARIT mit zwei Zielen, einerseits die drohende Überschuldung abzuwenden und anderseits eine Organisation zu schaffen, der alle Schweizer Informatikprofessoren angehören sollten. Beides gelang. Das zweite Ziel konnte mit einer recht speziellen Aufnahmeregelung in den Statuten erreicht werden. Statutenredaktion ist —nicht erst seit damals — inzwischen beinahe zu einem von Zehnders Hobbys geworden.
Politik — aber im Hintergrund
Viele der hier geschilderten Tätigkeiten führten ganz selbstverständlich zu Kontakten mit Politikern aller Stufen, bis hinauf zum Bundesrat und zu mehreren Kantonsregierungen, also auch zur Mitarbeit in Kommissionen und Projekten, gelegentlich zum Aufräumen in Problemfällen. Das war so spannend und verantwortungsvoll, dass Zehnder diese Tätigkeit — als politisch höchst interessierter Mensch — schon früh als interessanter und vor allem als wirkungsvoller empfand als eine Tätigkeit etwa in einem Parlament mit seinem zeitaufwendigen Betrieb. Er blieb daher ausserhalb der Parteipolitik, trotz klarer Sympathien für christliche Grundsätze und wirtschaftlich tragbare Lösungen.
Bei solchen Tätigkeiten konnte er seine Interessensgebiete wie Informatik-Projektführung, Datenbanken mit grossen Informationssystemen, Datenschutz und Verbandsführung optimal miteinander verbinden. In vielen schwierigen Fällen konnte er helfen, Probleme zu lösen, meistens übrigens mit wenigen, aber gezielten Ratschlägen für tolerantere Informatikentscheide. Wer nämlich die Informatik im Verwaltungseinsatz als Druckmittel zur zwangsweisen Einführung neuer Arbeitsmethoden oder Organisationsstrukturen missbrauchen will, scheitert damit häufig.
Solche Vermittlungsaufgaben fielen oft kurzfristig an, etwa 1991 bei der Informatikeinführung im eidgenössischen Parlament (für Ratsmitglieder und Parlamentsdienste) und bei der Überprüfung des Auskunftssystems in der sog. «Fichen-Affäre», oder 1993 anlässlich des sog. «EDV-Debakels» in der Stadt Zürich. Hierher gehört auch der «Mac/Windows»-Streit in Zürich von 2002 samt Volksabstimmung, worüber heute kein Mensch mehr spricht. In einigen dieser Fälle blieb nach dem kurzfristigen Hilfseinsatz ein jahrelanger guter Kontakt mit den Informatik-Verantwortlichen der betreffenden Verwaltungsstellen bestehen, der dem Hochschulprofessor tiefe Einblicke in den Alltag der Verwaltungsinformatik erlaubte und damit auch seine Lehrtätigkeit befruchtete. Im Bundesbern und besonders bei parlamentarischen Kommissionen konnte er in den letzten Jahren bei heiklen Projekten mit wissenschaftlicher, aber auch mit moralischer Autorität und mit erfahrener Didaktik entscheidend zu Lösungen beitragen: für die Einführung der neuen AHV-Nummer, für die Registerharmonisierung, für die auf harmonisierten Registern basierende künftige Volkszählung; auch den Datenschützer konnte er überzeugen.
Auf lokaler Ebene gehören selbstverständlich auch Aufgaben für das Gemeinwesen zum Tätigkeitsbereich eines aktiven Mitbürgers. Einige Jahre in der Kirchenpflege, Informatikberatung für die Gemeinde und Mitwirkung bei historischen und kulturellen Aktivitäten sind Beispiele für Zehnders lokale Einsätze. Ihr Nutzen ist rasch sichtbar, für andere und für ihn selber.
Die Familie
Zum Glück hatte Carl August Zehnder im Hintergrund zeitlebens eine intakte Familie. Seine Frau Verena lernte er 1959 an einem Schulfest (am «Maienzug» in Aarau) kennen. 1964 heirateten sie, bekamen drei Kinder geschenkt (Monika 1966 in Boston, Martin 1971 und Daniel 1972 wieder in der Schweiz) und sind noch heute glücklich miteinander. Seine Frau hatte ihr Betriebswirtschaftsstudium in St.Gallen nach der Heirat abgebrochen (wie üblich damals) und in der väterlichen Firma die Buchhaltung betreut. Nach dem ersten Amerika-Aufenthalt war sie zuerst Familienfrau, bald nachher aber in eigenen, neuen Karrieren aktiv, darunter 20 Jahre als Gemeinderätin (wovon 8 Jahre als Frau Gemeindeammann), als kantonale Kirchenrätin und Grossrätin sowie als Präsidentin sozialer Gemeindeverbände und Institutionen. Dass inzwischen für sie und für ihn Grosseltern-Tätigkeiten dazugekommen sind, ist höchst erfreulich, beide sind dankbar dafür.
Geschätzte Damen und Herren,
Wie Sie hören konnten, besteht das Lebenswerk von Carl August Zehnder im Bereich der Informatik aus Beiträgen für deren Entwicklung, für deren Förderung, für deren Anwendung in den verschiedensten Bereichen, für deren Verständnis in Bevölkerung und Politk, für die Begeisterung der Jugend und für die Nachwuchsförderung in den Informatikberufen. - Lieber Professor Zehnder, die ganze Schweiz muss Ihnen dafür dankbar sein!
Informationsgesellschaft und Vertrauen
Carl August Zehnder
Sehr geehrte Damen und Herren
Zuerst darf ich dem Stiftungsrat und der Preis-kommission der Stiftung Dr. J. E. Brandenberger und deren Vorsitzenden ganz herzlich für den Preis danken. Ich verstehe diesen auch als Aufmunterung für alle Anstrengungen, welche in der stetig wachsenden Informationsgesellschaft nötig sind, um neue Gefahren zu erkennen und Gegenmittel dazu bereitzustellen. Eine solche Ge-fahr ist der Verlust von Vertrauen, wenn durch den Einsatz von informationstechnischen Mitteln der direkte Kontakt zwischen den Menschen seltener und schwieriger wird. Daher müssen die Menschen des 21. Jahrhunderts auch Massnahmen kennenlernen, welche das Vertrauen wiederum stärken können — eine aktuelle Aufgabe für die Schule. Dazu möchte ich Ihnen zum Thema vorerst zwei Beispiele und anschliessend vier wichtige Massnahmen vorstellen.
Beispiel 1
Das globale Finanzsystem hat uns in den letzten Wochen ein Schulbeispiel dafür geliefert, wie Vertrauen rasch verloren und nur äusserst mühsam wieder aufgebaut werden kann. Dabei liegt der Hauptgrund für den Vertrauensverlust darin, dass die Komplexität dieses Finanzsystems und der darin gehandelten Finanzprodukte auch von den professionellen Beteiligten nicht mehr voll-ständig durchschaut werden kann. Interessant ist an diesem Beispiel aber auch, dass bei Finanzprodukten sowohl die Objekte — das Geld — wie auch die Methoden und Werkzeuge ausschliesslich informationstechnische Gebilde sind, virtuell und nur in Computern realisiert, aber mit sehr konkreten Auswirkungen auf die reale Welt. Das ist Informationsgesellschaft.
Beispiel 2
Das World Wide Web und die darin angebotenen Informationsquellen: Wenn Schulkinder heute einen Vortrag halten müssen, gehen sie nicht mehr zuerst in die Bibliothek, sondern «ins Internet» und holen sich entsprechendes Material und wenn sie Glück haben gleich den ganzen Vortrag «vom Internet herunter». Ähnliches passiert natürlich auch an den Hochschulen etwa bei Semesterarbeiten, und es wird immer schwieriger, direkte Plagiate überhaupt zu erkennen. Aber die Mitverwendung fremder Quellen ist mit Quellenangabe durchaus in Ordnung und auch im späteren Berufsleben wichtig. Das Kernproblem liegt beim Web in der häufig problematischen Qualität der verfügbaren Daten. Im WWW kann jede und jeder unkontrolliert und praktisch gratis publizieren; jede Qualitätskontrolle fehlt, im Gegensatz etwa zu redigierten Zeitungen und lektorierten Büchern. Auch in Wikipedia, dem attraktiven und vielgenutzten modernen Lexikon-Ersatz im WWW, gibt es bereits nachgewiesene Beispiele für Manipulationen, etwa zu Gunsten von Firmen und Politikern. Auch das ist Informationsgesellschaft.
In der Informationsgesellschaft mit ihren neuen Möglichkeiten müssen wir uns offensichtlich auch mit neuen Problemen befassen, die nicht bloss technischer Art sind, sondern ganz generell das Vertrauen der Menschen in wichtige Einrichtungen unserer Gesellschaft nachhaltig erschüttern können. Ich möchte Ihnen nun in meinem Referat vier Aspekte näher vorstellen, deren Kenntnis die Vertrauensbildung in der Informationsgesellschaft verbessern kann und daher bereits der heranwachsenden Generation in unseren Schulen nahe gebracht werden sollte. Es sind dies virtuelle Welten, automatische Prozesse, die Komplexität und die Stabilität.
Virtuelle Welten
In unserem Schulsystem ist die Maturität jener Abschluss, der eine höhere Allgemeinbildung bescheinigt. Entsprechend enthält der Kanon der obligatorischen Maturitätsfächer das, was unsere Bildungspolitik zur nötigen Allgemeinbildung rechnet. Die Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gehören dazu, mit jüngst sogar wieder etwas erhöhtem Gewicht. Diese Naturwissenschaften mit ihren Experimenten und darauf aufbauenden Theorien haben die — eindrucksvolle — technische Entwicklung des 20. Jahrhunderts zutiefst geprägt; unsere ETH bildet dafür ein gutes Beispiel.
Aber unser Schulsystem hat noch nicht realisiert, dass seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, mit dem Aufkommen der Computer, vorerst in den Naturwissenschaften und etwas später auch in den Geisteswissenschaften neben Theorie und Experiment ein ganz neues, drittes Standbein der wissenschaftlichen Arbeit entstanden ist, nämlich die numerische Simulation, das Arbeiten mit virtuellen Modellen. In der Anwendung ist das Arbeiten mit computergestützten Modellen längst unverzichtbar geworden, denken wir etwa an die mehrtägige Wetterprognose, an die Entwicklung neuer Werkstoffe und Motoren, an Fahndungserfolge mit genetischen DNA-Analysen und Roboter-Bildern.
Für unsere Jugend gehört der Umgang mit virtuellen Welten bereits zum Alltag, etwa bei Computerspielen. Für einige — zum Glück nur eine Minderheit — sind Computerspiele sogar Realitätsersatz geworden und führen zu Abhängigkeiten, die mit Drogenkonsum vergleichbar sind. Aber auch für uns alle sind künstliche Bilder und Videofilme häufig so realitätsnah, dass wir nach einigen Tagen nicht immer sicher sind, ob wir einen bestimmten Sachverhalt in Realität oder nur im Bild oder als Video gesehen haben, was etwa bei Zeugenaussagen heikle Folgen haben kann.
Alle diese Modelle und Bilder basieren technisch auf im Computer gespeicherten Daten, also auf Angaben wie «Alter 14», «Haarfarbe braun», «spricht Berndeutsch». Auch Bilder und Sprache lassen sich heute durch Daten darstellen, die leider auch unvollständig oder gar falsch sein können. Wir alle kennen Beispiele von Daten-verfälschungen. Schon Laien können heute mit geeigneten Programmen auf ihrem Computer zu Hause Fotos beliebig verfremden. Profis aus der Werbebranche oder auch Kriminelle tun das mit Absicht und nicht immer zum Nutzen der Betroffenen und der Gesellschaft. Damit stellen sich bei Computermodellen alte Fragen in sehr aktueller Form:
Was ist «wahr»? Was ist «richtig»?
Und eine Stufe schwieriger
(etwa bei Prognosen):
Was ist «wahrscheinlich»,
und «wie wahrscheinlich»?
Solche und ähnliche Fragen müssen aber beantwortet werden, bevor virtuelle Modelle eingesetzt werden dürfen. Wo lernt man das? In der Schweizer Schule heute leider kaum. Denn die Informationswissenschaft, die das 21. Jahrhundert wesentlich prägen wird, ist noch längst kein obligatorisches Maturfach, auch wenn 2007 im Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) neu ein Ergänzungsfach «Informatik» fakultativ zugelassen wurde. Noch immer gibt man sich in unseren Schulen zufrieden mit etwas Medienkunde und ähnlichen weichen Themen. Ernst genommen, das heisst mit einer obligatorischen Matur-note gewürdigt, wird somit in der Schweiz der Umgang mit Information weiterhin nicht.
Automatische Prozesse
In der Informationsgesellschaft haben wir es nicht nur mit virtuellen Welten zu tun, sondern auch ganz handfest mit Steuerungen, wo Computer in unsere reale Welt eingreifen und über uns mindestens punktuell direkt verfügen. Die neue Métro in Lausanne fährt ohne Wagenführer, jedes Auto enthält mehrere Computer als Fahrhilfen, Herzschrittmacher verhindern Herzstillstand. Um solche informationstechnischen Konstrukte wenigstens dem Prinzip nach zu verstehen, sind minimale Kenntnisse über automatische Prozesse und deren Programmierbarkeit nötig. Beim Programmieren eines Automaten geht es darum, einzelne Befehlsschritte zu Sequenzen zusammenzubauen sowie zu Schleifen, die unter bestimmten Bedingungen gestartet und auch wieder abgebrochen werden können. Zentral ist auch das Konzept der Unterprogramme, mit denen sich Teilaufgaben selbständig organisieren und auslagern lassen. Mit diesen wenigen Grundbausteinen können automatische Prozesse aller Art beschrieben und gestaltet werden.
Begründetes Vertrauen in Computerprogramme und automatische Prozesse können nur Personen haben, welche wenigstens deren Grundaufbau überblicken können. Dazu sind elementare Pro-grammierkenntnisse nötig, die in einem Mittelschulfach Informatik vermittelt werden sollten. Es geht hier nicht um vertiefte Kenntnisse oder gar darum, dass jede Maturandin, jeder Maturand fähig sein müsste, anschliessend selber eigene Computeranwendungen zu programmieren. Vor etwa 20 Jahren haben genau solche Maximalforderungen mitgeholfen, die damaligen Ansätze zu einer besseren Gymnasial-Informatik abzuwürgen. Übrig geblieben ist dort inzwischen reine Informatikanwendung mit Büroprogrammen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, E-Mail und Surfen im WWW. Natürlich sind solche Anwenderkenntnisse heute für jedermann wichtig. Aber dazu muss man nicht ins Gymnasium, das passiert heute längst in der Volksschule und vor allem auch im Elternhaus. Informatikanwendung ist jedoch nicht Informatik.
Ins Gymnasium gehört hingegen dringend ein obligatorischer Einführungskurs in die Grundlagen der Informatik, wo elementare Konzepte der Programmierung und der Datenorganisation vermittelt und das Verständnis für automatische Prozesse samt möglichen Fehlerquellen geweckt und gefördert wird. In einem solchen «Fach Informatik» können jene Grundlagen vermittelt werden, die zum Verständnis unserer inzwischen schon stark mit Informatikmitteln angereicherten Welt nötig sind, ganz analog zu den etablierten Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie. Wer allerdings seine Zukunft in einem Informatikberuf sieht, braucht mehr, braucht ein Fachstudium an ETH/Uni oder Fachhochschule oder in anderen professionellen Ausbildungsgängen. Dabei ist die heute oft gehörte Angst unbegründet, dass Informatikberufe, namentlich die Programmierung, in Zukunft völlig in Billiglohn-länder abwandern würden. Nur bei Prozessen, die weltweit normierbar sind, kann deren Programmierung problemlos ausgelagert werden. Wer aber hochspezialisierte Arbeitsprozesse in Schweizer Unternehmen beobachtet, wird rasch feststellen, dass deren genaue Analyse und Automatisierung lokales Knowhow erfordert. Nicht ohne Grund werden Swatch-Uhren weiterhin in der Schweiz hergestellt, allerdings vollautomatisch. Das Hochlohnland mit seinen Qualitätsmassstäben ist da kein Hindernis, sondern eine optimale Basis.
Kampf der Komplexität
Die Informationsgesellschaft basiert auf informationstechnischen Grundlagen, und zwar auf digitalen Geräten (Hardware) einerseits, auf Programmen und Daten (Software) anderseits. Beide Bereiche haben im letzten halben Jahrhundert eine gewaltige Entwicklung erlebt. Geräteseitig ermöglichte erst der noch immer andauernde exponentielle Leistungszuwachs der Mikroelektronik jene Computer, Handys, Musik- und Videogeräte, wie sie vor kurzem noch undenkbar waren. Diese Geräte könnten aber ihre heutigen Leistungen nicht erbringen ohne die zugehörigen Programme. Und in diesen steckt die wohl grösste Gefahr für die Informationsgesellschaft und damit auch für das Vertrauen in deren Funktionsfähigkeit: Es geht um die Komplexität der Software-Lösungen. Gerade weil die Programme selber immateriell sind, gibt es praktisch keine Grenzen für deren Umfang — wir alle haben inzwischen unsere Erfahrungen gemacht mit immer umfangreicheren Anwenderprogrammen und überfüllten Datenträgern, von der Diskette über die CD-ROM bis zur DVD. Professionelle Programmsysteme umfassen Millionen von Elementarbefehlen, deren Fehlerfreiheit niemand mit Sicherheit garantieren kann.
Diese Unsicherheit beschränkt sich in der Informationsgesellschaft nicht allein auf einzelne Computerprogramme, sondern umfasst infolge der Vernetzungsmöglichkeiten über Internet und andere Netze eine Vielzahl von Teilbereichen und somit weitgehend die ganze globalisierte Welt. Aktuellstes Beispiel für diese komplexitäts-bedingten neuen Unsicherheiten ist die bereits genannte Bankenkrise der letzten Wochen. Wir erinnern uns aber auch an die Angst vor dem Milleniums-Datumswechsel. Jenes «Jahr-2000-Problem» hat die Informatikdienstleister der ganzen Welt insgesamt etwa 600 Milliarden Dollar an vorauseilenden Reparaturaufwendungen an alten Programmen gekostet. Unbewältigte Komplexität hat aber auch schon in der Schweizer Bundesverwaltung grossen Schaden angerichtet, etwa in der Pensionskasse des Bundes. Der Bericht jener PUK diente mir anschliessend als Sammlung von Beispielen, «wie man es nicht machen soll».
Was ist daraus zu lernen? Gerade im Bereich der immateriellen Programme und Daten muss Komplexität entschieden bekämpft werden. Mein Freund Niklaus Wirth hat mit seinen Programmiersprachen (Pascal usw.) dafür gute Grundlagen geschaffen und gleichzeitig «barocke Programmierung» zeitlebens angeprangert. Und ich habe in meinen Kursen für Informatik-Projektführung immer die 80-20-Regel (für Ökonomen: die Pareto-Regel) betont: Bei der Entwicklung grosser Programme entfallen etwa 80% des Aufwands auf die Bearbeitung der kompliziertesten 20% aller Fälle. Also lohnt es sich meistens, zu-allererst die kompliziertesten Fälle abzubauen. Komplexe Systeme sind undurchsichtig. Sogar dann, wenn sie fehlerlos arbeiten, belasten sie das Vertrauen. Und ohne Vertrauen kann eine Informationsgesellschaft nicht funktionieren.
Lob der Stabilität
Sehr viele Leute verbinden heute die Informatik und ihre Produkte mit «schnelllebig», «unstabil» und Hektik. Wer ein wirklich modernes Handy haben will, sollte sein altes alle sechs Monate durch ein neues ersetzen. Microsoft erfindet immer wieder neue Dokument-Formate, um den Benutzern die Nutzung alter Programme zu verleiden. Ein solcher Rhythmus verhindert aber den Aufbau von Vertrauen in eine neue Technik. Ich werde immer wieder, namentlich auch von Lehrkräften in allgemeinbildenden Schulen aller Stufen, auf diese Hektik angesprochen. Diese Hektik ist allerdings auch in der Informatik weder notwendig noch sinnvoll. Sie ist von Marktkräften getrieben, denn mit Informatikmitteln wird heute viel Geld umgesetzt. So geben etwa allein die Schweizer Banken pro Jahr 7.5 Milliarden Franken für die Informatik aus. Trotzdem wechseln diese Banken ihre Informatikmittel keineswegs kurzfristig aus, viele Bankapplikationen stehen 15 bis 20 Jahre im praktischen Einsatz, manche noch länger! Das Jahr-2000-Problem konnte ja nur deswegen entstehen, weil allzu viele alte Programme noch im Einsatz standen. Unsere Informationsgesellschaft und darin besonders die Schulen und die Lehrkräfte sollten daher zur Kenntnis nehmen, dass sich auch in der Informatik nicht alles jedes Jahr ändert. Grundsätzliches — ich nenne es Konzeptwissen — hat auch in der Informatik eine lange Gültigkeit, sonst würde es ja keinen Sinn machen, an den Hochschulen Informatikingenieure mehrere Jahre lang auszubilden. Demgegenüber ist das Produktwissen sehr kurzlebig mit einer Halbwertszeit von ein bis zwei Jahren, weil die Anbieter dauernd mit neuen Produkten ihre Konkurrenz ausstechen wollen. Das gilt übrigens für Geräte genau so gut wie für Programme.
Für die Schule hat diese Unterscheidung eine ganz wichtige Konsequenz: Sie soll sich auf Konzeptwissen konzentrieren. Einzelne Schüler bringen zwar heute bereits grosse Detailkennt-nisse im Computerbereich mit in die Schulstube und trumpfen damit auf — typisches Produktwissen! Da können und sollen Lehrkräfte nicht mithalten wollen, ich könnte es auch nicht. Wenn eine Lehrerin Informatikthemen in der Schule behandeln will, soll sie sich auf Grundsätzliches ausrichten, zum Beispiel darauf, wie man Informationen sucht und dazu geeignete Fragen formuliert. Auf der Gymnasialstufe gehören dazu Kenntnisse über automatische Suchprozesse, zusammen mit ersten Erfahrungen mit virtueller Modellbildung und anderen Grundlagen moderner Informationswelten.
Vertrauen
All diese geschilderten Aspekte
— der kluge Umgang mit virtuellen Welten,
— das Verständnis für automatische Prozesse,
— die Vermeidung von unnötiger Komplexität und
— der Erwerb von grundlegendem und damit auch stabilem Informatikwissen tragen dazu bei, dass die Informationsgesellschaft uns allen zum Nutzen und nicht zum Schaden gereicht. Nur so ist es möglich, dass wir mehr Vertrauen in die neue Technik haben und gleichzeitig Zusammenbrüche und Fehlentwicklungen vermeiden können.
Meine Damen und Herren,
Ich habe mir erlaubt, diese Anliegen in meine Dankesrede für den Dr. J. E. Brandenberger-Preis einzubauen. Unser Land gehört seit vielen Jahrzehnten zur Weltspitze bei der Nutzung der Informationstechnik, der Informatik. Leider hinkt aber unser Land sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch in den allgemeinbildenden Schulen bezüglich Informatikkenntnissen und Informatikverständnis deutlich hinter anderen Nationen her. Hier sind noch wichtige Schritte zu tun, damit auch in unserem Land möglichst viele Menschen begründetes Vertrauen in aus-gewählte Angebote der Informationsgesellschaft haben können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesen Anliegen.