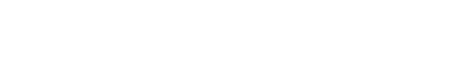2002 Hans Rudolf Herren

Hans Rudolf Herren, geboren am 30. November 1947 in Vouvry/VS, doktoriert 1977 an der ETH Zürich mit einer Arbeit über das Zusammenwirken von Schädlingen und Parasitoiden. Danach zwei Jahre an der University of California in Berkeley. 1979 Leiter der «Biological Control Unit» des International Institute for Tropical Agriculture (IITA) in Ibadan, Nigeria. Sein Konzept der biologischen Schädlingsbekämpfung bewahrte das Grundnahrungsmittel Maniok vor der Vernichtung, sicherte damit das Überleben von Millionen von Menschen. 1995 wurde er hierfür mit dem Welternährungspreis ausgezeichnet. 1994 bis 2005 Leiter des International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Kenia, findet dort biologische Lösungen für weitere Probleme, z.B. gegen Maisschädlinge. 2003 erhält er den Tyler Prize for Environmental Achievement. Ab 2005 ist er Präsident der Millennium Foundation in Arlington, Virginia (USA). Leitend aktiv in wichtigen einschlägigen internationalen Organisationen. 1998 Gründer von Biovision, einer gemeinnützigen Institution, welche die Methoden der nachhaltigen Landwirtschaft und biologischen Schädlingsbekämpfung in Afrika fördert.
Für seine wegweisenden Beiträge zur Sicherheit und Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung in Afrika durch die Entwicklung von der Umwelt angepassten land-wirtschaftlichen Produktionssystemen.
Laudatio
Ralf Hütter
Gemäss verschiedenen Autoren könnten wir mit der heutigen Produktion an Nahrungsmitteln über 10 Mrd. Menschen ernähren, vorausgesetzt, wir setzen die Portionen für alle auf 2700 Kalorien pro Tag fest, haben keine Verluste und garantieren eine regelmässige Verteilung der Nahrungsmittel. Bei einer Weltbevölkerung von heute gut 6,8 Milliarden (April 2010) hätten wir theoretisch also genügend Reserven.
In Tat und Wahrheit leiden weltweit aber 840 Millionen Leute unter Hunger oder Unterernährung. Im internationalen Jargon des IFPRI. des International Food Policy Research Institute, werden diese Leute — mir scheint etwas technokratisch — als (food-insecure> bezeichnet. Jährlich sterben 5 Millionen Menschen an Hunger oder den direkten Folgen davon, das sind 10 Menschenleben pro Minute. — Von Hunger und Unterernährung sind Entwicklungsländer ganz speziell betroffen, in Asien, im pazifischen Raum und besonders in Afrika. In Afrika südlich der Sahara ist und bleibt das Problem gravierend: Rund ein Drittel der Bevölkerung leidet an Unterernährung und Hunger.
Hunger trifft— in Entwicklungsländern und in Industrieländern — nur die Armen. Josu de Castro hat das 1977 in seinem Buch über «The Geopolitics of Hunger» wie folgt formuliert: «Those who have money eat. Those who have not die or become invalids.» Das ist immer noch gültig. Hunger und Unterernährung sind also nicht allein eine Frage der Grundverfügbarkeit an Nahrungsmitteln, sondern auch von Einkommen und damit auch von Arbeit. Die Armen verfügen nicht über die nötigen organisatorischen und vor allem nicht über die nötigen finanziellen Mittel, sich allenfalls verfügbare Nahrungsmittel zu beschaffen. Man darf also mit Fug und Recht behaupten, dass — würden die Nahrungsmittel weniger kosten — viele Arme weniger hungern müssten. Oder umgekehrt, falls die Armen mehr Einkommen hätten, könnten sie sich eine bessere Ernährung leisten. Allerdings darf man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass Einkommenssteigerungen unmittelbar zu einer Verbesserung der Ernährungslage führen.
Es wird jedoch allgemein anerkannt, dass für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern eine konkurrenzfähige Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielt. Ernährungssicherung, Armutsbekämpfung und Schutz der natürlichen Ressourcen sind dazu passende Stichworte.
Anhand von drei Beispielen soll gezeigt werden, welche Beiträge Herr Herren im Kampf gegen Elend, Hunger und Krankheit geleistet hat und leistet. Es sind drei Mosaiksteine in einem Bild, das bedeutend vielfältiger ist. Aber drei Beispiele müssen heute genügen. Zudem ist die Darstellung stark vereinfacht, und die Wirklichkeit verhält sich nicht so unilinear und wenig-dimensional, wie ich sie darstelle.
Erstes Beispiel. Cassava, die Schmierlaus und die Schlupfwespe
Cassava ist eine heute in den Tropen und Subtropen weit verbreitete strauch- bis baumartige Pflanze, die grosse stärkereiche Wurzelknollen bildet. Cassava stellt in vielen Gebieten eine sehr wichtige, z.T. für arme Bevölkerungsschichten die wichtigste Quelle kohlehydratreicher Nahrung dar. Die Blätter dienen — für Mensch und für Tier — auch als eiweisshaltige Nahrungsbestandteile. Bei uns ist Cassava eher unter der Bezeichnung Maniok bekannt, und manche mögen sich vielleicht noch an das Stärkeprodukt Tapioka erinnern.
Cassava stammt aus Südamerika, wo die Pflanze bereits in vorgeschichtlicher Zeit kultiviert worden ist. Cassava gelangte wohl Ende des 16. und im 17. Jahrhundert mit den Portugiesen nach Afrika und später auch nach Asien. In Afrika fand die Pflanze bald eine gewisse Verbreitung und stellt heute in manchen Ländern Zentral- und Ostafrikas eine der am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen dar.
Dies ging lange Zeit ganz gut, bis Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre die Cassava-Schmierlaus (engl. «mealybug») aus Südamerika nach Afrika eingeschleppt wurde. Diese Schmierlaus breitete sich rasch aus, im Schnitt etwa 300 km im Jahr, und es drohte der Kollaps der Nahrungsmittelbasis von rund 200 Millionen Menschen. 1984 waren über 30 Länder betroffen, und die Ernteverluste wurden auf rund 2 Milliarden US Dollar geschätzt. Was war zu tun? Die Bekämpfung mit chemischen Insektiziden zeigte zwar Erfolge, hatte aber auch Nachteile.
Herr Herren kam nach seinem Studium, 1969 bis 1973, und der Dissertation, 1973 bis 1977, an der ETH Zürich und seinem Postdoc-Aufenthalt an der University of California in Berkeley im Jahre 1979 ans IITA, das International Institute for Tropical Agriculture, mit Hauptsitz in Ibadan, Nigeria. Er wurde Leiter der «Biological Control Unit», einer realen Einheit, denn Herr Herren war anfänglich der einzige wissenschaftliche Mitarbeiter dieser Einheit. Er setzte sich für die alternative Methode der integrierten Schädlingsbekämpfung ein, das IPM, Integrated Pest Management. Das Zusammenwirken von Schädling und Parasitoid hatte er in seiner Dissertation bei Prof. Vittorio Delucchi eingehend kennen gelernt, und zwar am Beispiel des Lärchenwicklers und seiner Parasitoiden im Engadin.
Das IITA ist eine Institution des international tätigen CGIAR-Systems (Consultative Group of International Agricultural Research), dem u.a. auch das CIAT, das Centro Internacional de Agricultura Tropical mit Hauptsitz in Cali, Kolumbien, angehört. Das CIAT hat innerhalb des CGIAR-Systems das Mandat, die Aktivitäten auf dem Gebiete von Cassava zu koordinieren. Dazu gehört u.a. auch das Studium der Kulturpflanze selbst, der Züchtung und des Anbaus, der Schädlinge und Krankheiten und von Behandlungsmethoden. Am CIAT arbeitete seinerzeit ein bekannter Entomologe, Dr. A. Bellotti. Er entdeckte 1981 in Paraguay einen Parasiten der Cassava-Schmierlaus, eine kleine Schlupfwespe. In Paraguay wurde die Schmierlaus durch die Schlupfwespe unter Kontrolle gehalten, und es hatte sich so etwas wie ein Gleichgewicht zwischen Schmierlaus-Population und Schlupfwespen-Population eingestellt. Aber in Afrika war diese Schlupf-wespe nicht vorhanden.
Nun waren die vier Bestandteile für das weitere Geschehen gegeben: Grosse Anbaugebiete für Cassava, rasche Ausbreitung der Schmierlaus, die von Dr. Bellotti vom CIAT gefundene Schlupfwespe und Dr. Herren vom IITA. Für den weiteren Verlauf des Dramas musste der Knoten aber noch geschnürt und schliesslich zugezogen werden. Hier kamen die Erfahrungen von Dr. Herren, sein Organisationstalent und sein Durchsetzungswillen voll zur Geltung.
War die Schlupfwespe in Afrika überlebensfähig? Konnte sie gezüchtet werden? Wie konnte man sie rasch grossräumig verbreiten? Würde sie die einheimische Insektenfauna stark stören? Diese und andere Fragen galt es zu prüfen. Dazu war viel Arbeit am IITA und am CIAT nötig, und dazu beigetragen haben auch verschiedene Diplom-arbeiten und Dissertationen von Absolventinnen und Absolventen der ETH Zürich. — Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Schlupfwespe in Afrika in weiten Gebieten überlebens- und vermehrungsfähig war, dass sie in grossen Mengen gezüchtet und ausgebracht werden konnte und dass die einheimische Insektenfauna nicht in schwerwiegender Weise nachteilig beeinflusst wurde.
Am IITA ist ein Massenzuchtverfahren entwickelt worden, und die Schlupfwespen wurden mit Flugzeugen grossräumig ausgebracht. Mit einer mehrjährigen Kampagne (ab ca. 1984) konnte man der Cassava-Schmierlaus Herr werden, die Seuche unterbinden und damit die Ernährungsbasis von Millionen von Menschen in Afrika sichern.
Es war dies das bisher grösste und erfolgreichste Programm in integrierter Schädlingsbekämpfung, und es war damals auch der wesentlichste Faktor im Kampf gegen Hunger und Unterernährung in Afrika. Der enorme Erfolg machte Herrn Dr. Herren schlagartig berühmt und brachte ihm zahlreiche Anerkennungen ein, am wichtigsten 1995 den World Food Prize.
Was können wir mitnehmen aus diesem Beispiel?
— Cassava ist als Kulturpflanze aus Amerika nach Afrika gebracht worden, der Kulturpflanze folgte der Schädling aus Amerika, und auch der Parasitoid, die Schlupfwespe, stammt aus Amerika.
— Das Zusammenwirken zahlreicher Personen und Institutionen brachte schliesslich ein System hervor, mit dem die Seuche weitgehend unter Kontrolle gebracht werden konnte.
— Es brauchte einen «champion», jemanden, der ein solches Programm mit Herz, Verstand und Persistenz verfolgte. Herr Herren war dieser «champion».
Bei der Einführung der Kulturpflanze Cassava hat niemand an sogenannte Bioverträglichkeits-Studien gedacht, auch die Schmierlaus hat sich nicht darum gekümmert. Und auch der Einsatz der Schlupfwespe war nur von punktuellen Biosicherheitsüberlegungen und -studien begleitet. Trotzdem ist alles gut gegangen.
Zweites Beispiel. Der Mais, der Stengelbohrer und das Push-Pull-Prinzip
Wieder haben wir es mit einer für Afrika - wie auch für Europa und Asien — fremden Kultur-pflanze zu tun. Der natürliche Standort von Mais ist Zentralamerika, und Mais fand in ganz Amerika schon in vorgeschichtlicher Zeit eine weite Verbreitung.
Mais kam schon Anfang des 16. Jahrhunderts mit den Spaniern und Portugiesen zuerst auf die iberische Halbinsel, später auch nach Afrika und Asien. Nach Ostafrika gelangte der Mais vor gut 100 Jahren. Mais wurde in Afrika von einheimischen Stengelbohrern befallen. Stengelbohrer sind Insekten, die ihre Eier auf ausgewählte Pflanzen ablegen und bei denen die daraus ausschlüpfenden Raupen sich in das Stengelgewebe hineinfressen und dadurch die Pflanze schädigen. Die afrikanischen Stengelbohrer haben aber beim Mais keine allzu grossen Schäden verursacht, denn sie zogen als Wirtspflanze für die Eiablage und weitere Entwicklung einheimische Gräser vor.
Um 1930 wurde aber aus Indien ein neuer Stengelbohrer, Chilo partellus, eingeschleppt, ein mottenartiges Insekt. Dieser indische Stengelbohrer befiel Mais stark und breitete sich rasch aus. Neben der Schädigung durch den neuen Stengelbohrer kam hinzu, dass sich in den Maisfeldern ein Unkraut, Striga oder Hexenkraut, immer mehr ausbreitete und die Erträge reduzierte. Was konnte man tun? Auch hier schaltete sich Herr Herren mit seinen Konzepten und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.
Man wusste, dass Stengelbohrer für die Eiablage und weitere Entwicklung verschiedene Gräser bevorzugen, andere Pflanzen eher meiden. Es wurden ca. 400 verschiedene Gräser untersucht, und man fand, dass u.a. das afrikanische Elefantengras, auch Napiergras geheissen, ein attraktiver Wirt für die Eiablage des indischen Stengelbohrers war. Wenn einige Reihen Elefantengras um Maisfelder herum gepflanzt wurden, so legten die indischen Stengelbohrer die Eier bevorzugt auf dieses Gras, und der Befall des Mais wurde beträchtlich reduziert. Als zusätzlicher Gewinn stellte sich heraus, dass sich im Napiergras nur ca. 20% der Raupen des indischen Stengelbohrers zu ausgewachsenen Insekten entwickeln. Damit war die «Pull»-Komponente gefunden: Elefantengras zieht die Motte für die Eiablage aus dem Feld.
Weiter fand man, dass das Anpflanzen von Des-modium uncinatum zwischen den Maispflanzen die Stengelbohrer-Motte aus den Maisfeldern vertreibt; Desmodium stinkt, zumindest nach dem Geschmack des Stengelbohrers. Bei Desmodium uncinatum handelt es sich um ein im tropischen Südamerika beheimatetes bohnenartiges Gewächs, das vielfach verschleppt worden ist und u.a. auch in Afrika kultiviert wird. Damit war die «Push»-Komponente gefunden: Desmodium verscheucht die Motte aus dem Maisfeld.
Der Anbau von Desmodium zwischen den Maispflanzen, ein sogenanntes «intercropping», hatte zudem die Vorteile, dass dadurch das eingangs erwähnte Hexenkraut unter Kontrolle gebracht werden konnte, dass durch die Bodenbedeckung die Erosion reduziert wurde, dass eine zusätzliche proteinreiche Futterpflanze für das Vieh zur Verfügung stand und schliesslich, dass Desmodium als Leguminose Stickstoff fixierte und damit zu einer gewissen Düngung der Maispflanzen beitrug.
Als weiteres Element in der Bekämpfung des indischen Mais-Stengelbohrers kann, analog zum Beispiel von Cassava, eine Schlupfwespe eingesetzt werden. Mit der «Push-Pull»-Methode werden die Stengelbohrer nur vertrieben, nicht wirklich bekämpft. Eine in Indien gefundene Schlupfwespe, Cotesia flavipes geheissen, führt aber zur Abtötung der Stengelbohrerlarven. Die Schlupfwespen legen ihre Eier in die Stengelbohrerlarven; die daraus ausschlüpfenden Wespenlarven fressen die Stengelbohrerlarven dann von innen her auf.
Insgesamt braucht es also hier ein Mehrkomponenten-System: Elefantengras zum Anziehen der Motte, Desmodium zum Vertreiben der Motte, die Schlupfwespe zur Bekämpfung der Motte, ganz zu schweigen vom Mais, den man ja schliesslich noch reichlich ernten will.
Dass ein solches Mehrkomponenten-System Mehrarbeit und Mehraufwand verursacht, ist ein
leuchtend. Dass dies durch Mehrertrag überkompensiert werden sollte, ist der Zweck der Übung. Insgesamt handelt es sich aber um ein System, das bei guten Bedingungen und bei richtigem Einsatz eine Kontrollmethode für den Mais—Stengelbohrer darstellt, die für die arme, ländliche Bevölkerung in Afrika in manchen Gebieten anwendbar ist. Doch muss das System richtig gehandhabt werden, z.B. bezüglich Zeitpunkt der Pflanzungen oder der Dichte des «intercropping», damit die gewünschten positiven Wirkungen erreicht werden. Es braucht eine entsprechende Ausbildung der Bauern, und — damit das gemacht werden kann — braucht es Landwirtschaftsberater. Wiederum, dies zum Schluss, finden wir ein «globalisiertes» System: der Mais aus Amerika, der Schädling diesmal vom indischen Subkontinent, das Elefantengras aus Afrika, Desmodium aus Amerika und die Schlupfwespe wieder aus In-dien. Auch hier ist das System ohne ausgedehnte Biosicherheitsforschung entwickelt worden.
Drittes Beispiel. Die Tse-Tse-Fliege, die blaue Falle und der Ökotrainer
Während für Pflanzen Insekten wichtige und z.T. verheerende Schädlinge sind, ist bei Tier und Mensch der direkte Schaden durch Insektenbefall im allgemeinen wesentlich geringer. Allerdings gilt dies nicht für indirekte Wirkungen. Insekten sind häufig Überträger von schlimmen Krankheiten, so z.B. auch die Tse- Tse-Fliegen für die Schlafkrankheit oder die Anopheles-Mücken für die Malaria. In Afrika sterben jährlich immer noch 400000 Menschen an der Schlafkrankheit, und viele mehr leiden unter den indirekten Auswirkungen der Krankheit.
In einem Gebiet von Äthiopien z.B. verhindert die Tse-Tse-Fliege infolge der Übertragung der Schlafkrankheit auf den Menschen und der Naganaseuche auf die Rinder die Nutzung fruchtbaren Bodens in den mit Wasser genügend versorgten Tälern. Die Bauern ziehen sich auf die trockeneren, aber auch kargeren Hänge und Höhen zurück, wodurch die Ernährungsbasis empfindlich geschmälert wird.
Tse-Tse-Fliegen können auf verschiedene Weise bekämpft werden. Der Einsatz von Chemikalien ist nicht immer von Erfolg gekrönt, es kann zu Resistenz- und Toleranzentwicklung kommen, die Behandlungen können kostspielig sein und sind nicht immer umweltgerecht.
Auch die Gruppe von Dr. Herren hat sich der Tse-Tse-Fliege und deren Verhalten angenommen. Was zieht Tse-Tse-Fliegen an, was stösst sie ab? Im Verlaufe dieser Studien hat man festgestellt, dass die Tse-Tse-Fliege ein intensives Blau und den Duft von Rinderurin lieben und dadurch angelockt werden. Darauf basierend ist ein blaues Fangzelt mit Rinderurin als Duft-Lockstoff entwickelt und zuerst in Kenia mit Erfolg ausprobiert worden. Wie funktioniert das System? Die
Tse-Tse-Fliegen werden durch das blaue Fangzelt angelockt und geraten ins Zeltinnere. Die Tse-Tse-Fliegen wollen wieder aus dem Zelt entweichen und geraten dabei in eine oben am Zelt angebrachte helle Plastikreuse. Aus dieser Reuse gibt es aber kein Entrinnen, und die Fliegen sterben in der Tropenhitze ab. Herstellen, Aufstellen und Unterhalt einer solchen Falle kosten 35 Schweizerfranken, der heutige Brandenberger-Preis würde also, ohne Mengenrabatt, für rund 6000 Fallen reichen.
Wesentlich ist es, dass die Bevölkerung, die diese Fallen schliesslich nutzen soll, in die Herstellung mit einbezogen und in der Handhabung geschult wird. Dies geschieht durch die lokale Beratung durch ausgebildete sogenannte Ökotrainer.
Auch in diesem Fall ist eine umweltschonende Bekämpfungsmethode entwickelt worden, die von der lokalen Bevölkerung selbst eingesetzt werden kann.
ICIPE und Biovision
Die genannten drei Beispiele haben, wie ich hoffe, illustriert, nach welchen Prinzipien Herr Dr. Herren und sein Team arbeiten und wie stets versucht wird, den lokalen Gegebenheiten angepasste Lösungen zu entwickeln. Doch eine Würdigung der Arbeit von Herrn Dr. Herren wäre unvollständig, würde nicht zumindest noch etwas gesagt zum ICIPE und zu Biovision.
Zuerst zum ICIPE, dem International Centre of Insect Physiology and Ecology in Nairobi, Kenia. Bei der Gründung des ICIPE 1970 war das Hauptanliegen, Strategien und Systeme zum Management von durch Insekten verursachte Seuchen zu entwickeln, und zwar solche Verfahren, die selektiv sind, möglichst keine Resistenzentwicklung nach sich ziehen, die Umwelt nicht belasten und für die arme Landbevölkerung erschwinglich sind. Diese Zielsetzung besteht immer noch, doch ist die Agenda wesentlich ausgeweitet worden, besonders nachdem Herr Herren 1994 die Direktion des ICIPE übernommen hatte. Er hat der Institution ein neues Gesicht gegeben, nicht nur in organisatorischer Hinsicht — Stichwort clean management> — und bezüglich der finanziellen Basis, sondern vor allem durch eine neue Arbeitsagenda.
Hauptanliegen sind die Minderung der Armut einerseits und andererseits die Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit der Bevölkerung in tropischen Gebieten durch das Management und die Kontrolle von schädlichen und nützlichen Insekten. Die zugrunde gelegte Strategie heisst 4H: Human, Animal, Plant and Environ-mental Health. Es geht um Gesundheit als Basis für die Entwicklung, es geht um Biodiversität und Umwelt als Basis für Nachhaltigkeit, und es geht um Arbeit und Einkommen zur Verbesserung des Lebens armer Bevölkerungsgruppen.
Die Forschungsagenda berücksichtigt bei den konkreten Projekten sowohl die Anliegen der Endnutzer, also der armen Landbevölkerung, als auch der Donatoren. Es geschieht dies in einem breiten Netzwerk mit Institutionen des CGIAR-Systems, mit nationalen und regionalen Zentren und anderen interessierten Kreisen.
Zwei Beispiele der Arbeit, Mais-Stengelbohrer und Tse-Tse-Fliege, haben wir kennen gelemt. Daneben gibt es Projekte über Heuschrecken, die Mangofruchtfliege, Seidenraupen, Honigbienen, Malaria «repellents», Termiten, um nur wenige weitere Beispiele zu nennen.
Zur Arbeit gehört auch die Aufnahme der In-sekten-Biodiversität in Afrika. Es wird geschätzt, dass in Afrika über 500000 Insektenarten existieren, von denen aber erst rund 100000 bekannt sind. Es gilt, das vorhandene Wissen auch darüber zu katalogisieren und zu erweitern. —Bei der rasanten Ausweitung unserer Kenntnisse über Insekten, ihr Verhalten und ihre Wechsel-wirkungen mit Pflanze, Tier und Mensch wird die Verbreitung etablierter Erkenntnisse zu einer zentralen Aufgabe. Dafür braucht es einerseits ausgebildete Fachkräfte, andererseits den Einsatz der heute verfügbaren Informatikmittel.
Der Ausbildung von Fachkräften wird am ICIPE gebührende Aufmerksamkeit geschenkt, wie wir das schon an den Beispielen des Mais-Stengelbohrers und der Tse-Tse-Fliege erwähnt haben (Landwirtschaftsberater und Ökotrainer). Am ICIPE ist zudem ein regionales Postgraduierten-Programm in Entomologie (Insektenkunde), in Partnerschaft mit über zwei Dutzend afrikanischen Universitäten, entwickelt worden. Daraus erhofft man sich schliesslich auch vermehrte Forschungsaktivitäten an den beteiligten Universitäten. — Auch wird dem Einsatz moderner
Informationstechnologie gebührend Beachtung geschenkt. So steht u.a. in den Dokumentationen des ICIPE zu lesen: «Information technology, much more than biotechnology, will be the real motor behind sustainable development.» Nun, man mag das auch etwas anders gewichten, doch steht sicherlich fest, dass die Verbreitung der verfügbaren Informationen zum schonenden Umgang mit Ressourcen und zum Handhaben neuer Erkenntnisse wichtig ist. Das vom ICIPE ausgehende Netzwerk leistet dazu einen Beitrag. Ich komme nicht darum herum, in Verbindung mit Herrn Herren und dem ICIPE auch etwas zur Biotechnologie zu sagen. Drei Ausschnitte aus Artikeln aus dem oder über das ICIPE sollen die Situation illustrieren:
1. «Genetically modified (GM) insecticidal crops therefore hold enormous potential for increas-ing food security in Africa. However, if and when GM crops are to be deployed, they will have to fit into an integrated pest management strategy and become one of several options offered to farmers.»
2. «A number of issues should be addressed be-fore the widespread introduction of GM crops, e.g.
· risks to non-target organisms
· risks to soil-microfauna
· movement of transgenes, in particular to wild relatives
· selection pressure an insects
· assessment of benefits»
3. «Hans Herren is critical, but he is not a strict
enemy of genetic engineering Possibly, transgenic maize will be part of the solution in the far future.»
In weiterer Zukunft geht es ja bei weitem nicht nur um insekten- oder herbizidresistente Kulturpflanzen, sondern u.a. auch um bessere Produktequalität, Trockenheitstoleranz, Salztoleranz, Phosphat-Aufnahme und vieles mehr. — Zugegeben. es gibt in Verbindung mit dem ICIPE und Dr. Herren auch andere, z.T. gegenläufige Bemerkungen. Meinen Sympathien entsprechend, habe ich jedoch die vorgängig zitierten Stellen ausgewählt. Aber wir können den oben aufgeführten (issues> in manchem zustimmen: Es braucht für GM-Pflanzen Nutzen-Schaden-Abklärungen. Doch, dies sei mir zu erwähnen gestattet, solche Abklärungen müssten bei allen neuen Behandlungsmethoden und beim Einführen fremder Faunen und Floren in gegebene Ökosysteme durchgeführt werden. Es gibt schliesslich genügend Beispiele für ungünstige Auswirkungen auf die Biodiversität nach dem Einführen fremder Pflanzen und Tiere — oder dem Ändern von Anbausystemen.
Noch ein kurzes Wort zu Biovision. Am 3. Juni 1998 ist in Zürich der gemeinnützige Verein Biovision gegründet worden. Präsident des Vereins und erster Grosssponsor ist Herr Herren. Der Verein Biovision ist ein Gefäss zur Verbreitung des Wissens über die Anwendung biologischer Schädlingsbekämpfungsmethoden, insbesondere in Afrika, zugleich über den Einsatz von Herrn Herren zur Verbesserung der sozialen und materiellen Lebensbedingungen der armen Landbevölkerung in Afrika und über sein Engagement für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Und natürlich ist es auch ein Gefäss zur Geldbeschaffung. Der kürzlich erfolgte Spendenaufruf von Biovision stellt den Kampf gegen die Schlafkrankheit in Äthiopien mit den blauen Tse-Tse-Fliegen-Fangzelten in den Vordergrund. Übrigens: Spenden können von den Steuern abgezogen werden.
Schlussworte
Nun haben wir viel über die Arbeit von Herrn Herren und deren Auswirkungen gehört, aber noch wenig über ihn selbst. Doch das soll jetzt nachgeholt werden.
Wir haben erwähnt, dass Dr. Herren 1995 den World Food Prize erhalten hat. Er erhielt den Preis «in recognition for having advanced human development by improving the quality and availability of world's food supply.» Im gleichen Jahr 1995 erhielt er auch den Kilby Award «for extraordinary contribution to society through science» und die Anerkennungsmedaille der African Association of Insect Scientists.
Wir haben auch bereits erwähnt, dass er 1994 die Direktion des ICIPE übernommen hat, und mit welchen Folgen. Ebenso wissen wir, dass er 1979 ans IITA gekommen ist. Zuerst war er dort Leiter der «Biological Control Unit», dann «Director of the Biological Control Programme» und schliesslich «Director of the Plant Health Management Division».
Kurz kam auch zur Sprache, dass Herr Herren zwei Jahre zwischen 1977 und 1979 als Postdoktorand an der University of California in Berkeley war. Dafür stand ihm ein Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds zur Verfügung. Vorher hatte er 1973 bis 1977 bei Prof. V. Delucchi und Dr. W. Baltensweiler an der ETH Zürich doktoriert. Ich möchte Ihnen den Titel der Dissertation Nr. 6037 nicht vorenthalten, er lautet «Le rôle des eulophides dans la gradation de la tordeuse grise du mélèze, Zeiraphera diniana Guenée (Lep. Tortricidae) en Haute-Engadine». Warum französisch, wird bald deutlicher werden.
Bis jetzt noch nicht aufgeführt worden sind weitere Ehrungen, die Herrn Herren während und nach diesen Arbeitsphasen zuteil wurden. Davon möchte ich vier erwähnen: 1986 den Parasitis-Preis «for planning and implementing the world's largest biological control project», 1990 für das IITA und das CIAT den King Baudouin Award, 1991 aus der Hand von Frau Thatcher den Sir and Lady Rank Prize for Nutrition, und 1999 wurde er schliesslich «Foreign Associate» der US Academy of Science.
Es bleibt noch die weitere Herkunft von Herrn Herren auszuleuchten. Auf das Studium in Landwirtschaft von 1969 bis 1973 an der ETH Zürich hat er sich während der Jahre 1965 bis 1968 am Humboldtianum in Bern vorbereitet. Dies, nachdem er in Châteauneuf, im Wallis, 1963 bis 1965 die Kantonale Landwirtschafts-Schule absolviert und als Diplom-Landwirt abgeschlossen hatte. Die Schulausbildung genoss er in Vouvry im Wallis, wo er auch vor genau 55 Jahren, am 30. November 1947, geboren wurde. Somit sind wir am Anfang und am Schluss.
Es bleibt mir die Freude, Herrn Herren für den Preis der Stiftung Dr. J. E. Brandenberger zu gratulieren, aber auch ihm zu seinem heutigen Geburtstag herzlich Glück zu wünschen. Alles Gute und weiterhin erfolgreiche Arbeit!
«Entwicklungszusammenarbeit beginnt mit Zuhören - auch der Natur»
Hans R. Herren
Sehr geehrte Damen und Herren
Es ist mir eine grosse Ehre, und ich freue mich ausserordentlich, dass ich zum Träger des Brandenbergerpreises 2002 gewählt wurde. Dieser Preis ist für mich eine wertvolle Anerkennung, die ich sehr gerne annehme. Damit unterstreicht die Stiftung Dr. J.E. Brandenberger ihre Weltoffenheit und ihre Solidarität mit den Ländern des Südens, in welchen die Menschen sehr oft ein hartes Schicksal zu tragen haben. Solche Verbundenheit mit den benachteiligten Entwicklungsländern ist heute in der Schweiz leider keine Selbstverständlichkeit. Gerade in jüngster Zeit nimmt die undifferenzierte Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit zu. Diese sei ineffizient, heisst es etwa. Oder das Geld für Afrika bringe sowieso nichts, man solle diese Leute doch sich selbst überlassen.
Solche Äusserungen betrüben und erzürnen mich. Denn sie entsprechen einer Haltung, die meiner eigenen Überzeugung und Erfahrung widerspricht. Ich bin seit Jahrzehnten eng mit Afrika verbunden, habe dort während 27 Jahren in verschiedenen Ländern gearbeitet und gelebt, habe den Kontinent kreuz und quer bereist, und ich kenne viele Länder samt ihren Menschen und ihren Problemen aus eigener Anschauung. Vor diesem Hintergrund sind die erwähnten Pauschalurteile für mich inakzeptabel. Afrika ist ein Kontinent mit 53 Staaten, 850 Millionen Menschen und über 2000 verschiedenen Sprachen. Wie kann man diesen Riesenkontinent, dessen Vielfalt unserem kleinen Land tausendfach überlegen ist, nur so simpel über einen Leisten schlagen? Die Probleme in den einzelnen Ländern Afrikas sind sehr unterschiedlich. Eines aber ist im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit wesentlich: Die Leute wurden in der Vergangenheit oft gar nicht gefragt, was sie eigentlich wollen. Nach meiner Erfahrung können die Menschen vor Ort viel besser einschätzen, was sie brauchen und was bei ihnen funktioniert. Darum beginnt Entwicklungszusammenarbeit mit Zuhören.
Abb. 38: Hans Rudolf Herren lebte und forschte während 27 Jahren in Afrika.
Dieser Ansatz wird etwa von der Stiftung Bio-vision verfolgt, die ich 1998 mit Gesinnungsgenossen aus der Schweiz gründete mit dem Ziel, die Lebenssituation der Menschen in Afrika nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig die Natur als Grundlage allen Lebens zu erhalten. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass die Kooperation nicht korrupte Eliten unterstützt, welche leider in vielen Entwicklungsländern die Fäden in der Hand halten. Darum haben wir am ICIPE, dem internationalen Insektenforschungsinstitut in Nairobi, welches ich als Director General selber leite, in den vergangenen 10 Jahren Dutzende von Wissenschaftlern ausgebildet, zusätzlich zu den über 120, die ich während dem biologischen Kontroll-Programm der Maniok-Schmierlaus ausgebildet hatte. Einigen von ihnen begegne ich heute in wichtigen Positionen. In Uganda arbeitet etwa ein ehemaliger Student als Leiter der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt. In Ghana hatte ein Student aus meinem Maniok-Schmierlaus-Programm die Position als stellvertretender Landwirtschaftsminister inne und ist heute FAO-Repräsentant in Liberia. Und in mehreren Universitäten Afrikas sind ICIPE-Absolventen zu Lehrbeauftragten und Professoren geworden. Solche Leute gilt es zu unterstützen, nicht die verkrusteten Strukturen, die es ermöglichen, dass egoistische Machthaber nach wie vor in vielen Ländern schalten und walten und die — nota bene — über Jahrzehnte von vielen Unternehmen und Regierungen der Industrienationen getragen und geschützt werden, zur Wahrung von deren eigenen Interessen.
Unbestritten ist: in Afrika funktionieren gewisse Dinge anders, als wir das gewohnt sind. Oft muss man zuerst in Menschen, nicht in Maschinen investieren. Deshalb braucht man auch einen längeren Atem als in unserer auf kurzfristigen Profit ausgerichteten industrialisierten Welt. Wichtig scheint mir, dass wir im Norden eine gewisse Bescheidenheit erlernen. Wir sollten uns öfters auf Projekte einlassen, die von Afrikanerinnen oder Afrikanern entwickelt wurden, auch wenn diese nicht genau unseren Vorstellungen entsprechen. Wenn man die Leute darin unterstützt, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, erzielt man oft die besseren Resultate, als wenn man sie zwingt, so zu funktionieren, wie wir uns das ausgedacht haben.
Erfolgreiche Entwicklungsprojekte gibt es zuhauf, und ich habe Hunderte davon gesehen. Die Frage ist nicht «Wie sinnvoll ist Entwicklungshilfe?», sondern: «WIE ist Entwicklungshilfe sinnvoll?» Die Antwort auf diese Frage findet man nicht in der Schweiz allein, sondern im Dialog mit den richtigen Leuten vor Ort.
In der Entwicklungszusammenarbeit werden oft zwei verschiedene Sichtweisen — nämlich die von oben und die von unten — gegeneinander ausgespielt. Ich plädiere dafür, dass man sie nicht getrennt betrachtet, sondern als zwei notwendige Kräfte in einem Prozess wahrnimmt. Ich brauche dafür gerne den Begriff <Push-Pull>, welcher Ihnen vielleicht als grundlegendes Prinzip der biologischen Schädlingsbekämpfung vertraut ist. Wenn man ein System verändern will, muss man oft von der einen Seite ziehen und von der anderen stossen. Dabei werden in der biologischen Schädlingsbekämpfung natürliche Stoffe, etwa Pflanzendüfte oder Farben eingesetzt, welche die Schädlinge vertreiben bzw. anlocken. Ich möchte Ihnen das kurz an einem konkreten Beispiel erläutern:
In vielen Teilen Afrikas verursacht eine Motte namens Stängelbohrer grosse Schäden im Mais. Die Motten legen nachts ihre Eier auf die Maisblätter. Die Larven schlüpfen und dringen in die Pflanzen ein. Sie höhlen die Stängel aus und verursachen damit gravierende Ernteausfälle: bis zu 40%. Noch schlimmer ist das Striga Unkraut. Seine Samen können lange Zeit im Boden überdauern. Sobald ein Maiskorn in der Erde keimt, erwacht die Striga-Pflanze und streckt ihre Wurzeln zum Maiskorn. Sie dringen in die Wurzelknolle der Maispflanzen ein und zapfen ihnen die Nährstoffe ab. Der Mais verkümmert und verdorrt, bevor die Kolben wachsen. In Ostafrika sind das Striga-Unkraut und der Stängelbohrer weit verbreitet. Wo sie gemeinsam vorkommen, kann das zum Totalverlust der Ernte führen. Mangel-Ernährung, Hunger und Armut sind die schlimmen Folgen.
Dr. Zeyaur Khan, einer meiner Wissenschaftler in der Forschungsstation des ICIPE in Mbita Point am Viktoriasee, hat im Kampf gegen den Stängel-bohrer die wirksame, biologische Push-Pull-Methode entwickelt, die bei allen Maissorten wirkt. Der Einsatz von Desmodium-Pflanzen, welche zwischen den Mais gepflanzt werden, verhindert das Wachstum des verheerenden Striga-Unkrauts, und die Pflanzen vertreiben mit ihrem Geruch die schädlichen Insekten aus dem Feld, bevor sie die Eier ablegen. Um die Äcker herum wird das klebrige Napiergras angepflanzt, welches die Stängelbohrer-Motten mit seinem Duft unwiderstehlich anlockt. Sie fliegen aus den Feldern und legen ihre Eier auf das klebrige Gras, wo die Brut eingeht. So kann der Mais geschützt werden; ohne Gentechnologie, ohne Chemie und ohne Umweltbelastung. Zudem sind Napiergras und vor allem Desmodium sehr nähr-stoffreiche Futterpflanzen. Sie ermöglichen den Bauern neben besseren Maisernten auch die Haltung von Milchkühen oder Ziegen und die Produktion von Milch. Push-Pull im Mais verbessert die Ernährungssituation der Kleinbauern und erhöht die Nahrungssicherheit. Zudem können sie Geld sparen bzw. verdienen durch den Verkauf Ihrer Überproduktion von Mais und Milch auf den lokalen Märkten.
Das wohl beste Beispiel, das mit meiner Brandenbergerpreis-Ehrung eng verbunden ist, ist das biologische Kontroll-Programm der Maniok-Schmierlaus. Ich habe in den 80er-Jahren dieses Schädlings-Kontroll-Programm entwickelt, das ohne Chemie auskommt. Die Methodik der biologischen Schädlingsbekämpfung ist ökologisch, einfach, effektiv und billig, und sie rettete Millionen von Menschen vor dem Hungertod. Diese Methode funktioniert noch heute ganz natürlich und kostenlos, weil sich Schädlinge und Nützlinge gegenseitig in Schach und damit im Gleichgewicht halten. Die Maniok-Schmierlaus war unabsichtlich von Südamerika, wo der Maniok ursprünglich her kommt, nach Afrika eingeschleppt worden. Das kleine Insekt konnte sich hier ungehemmt vermehren, dank der Abwesenheit von jeglichen natürlichen Feinden (sog. Nützlingen), denn diese hatte man nicht eingeschleppt! Dies hatte zur Folge, dass plötzlich die Grundnahrung von über 200 Millionen Menschen bedroht war. In vielen Gebieten Afrikas war die Maniok-Pflanze infolge des sehr schweren Befalls durch die Schmierlaus bereits ausgestorben, mit verheerenden Auswirkungen auf die Nahrungssicherheit der betroffenen Kleinbauern und auch der Urbanbevölkerung, die ebenfalls stark vom Maniok abhängig ist. Es herrschte ein dramatischer Handlungsbedarf. Ich hatte gerade mein PostDoc an der Universität Berkeley in Kalifornien abgeschlossen und war auf der Suche nach einer Herausforderung ...
Mit dem Auftrag, diesen Schädling in Afrika zu stoppen, hatte ich sie gefunden! Ich übernahm die Leitung des Maniok-Schmierlaus-Projektes in Nigeria im September 1979.
Die erste Hürde war: Geld für das Programm zu finden. Ich musste mit einem guten Konzept die Geldgeber überzeugen, mehrere Millionen Dollar locker zu machen. Das Geld kam zusammen, wenn auch nicht immer ganz einfach. Es ist mir gelungen, die vielen Skeptiker zu überzeugen, dass die nachhaltigste Lösung in der biologischen Schädlingsbekämpfung zu suchen sei. Nur mit diesem Ansatz, das war und ist meine Überzeugung, war dieses afrikaweite Problem ökonomisch und ökologisch zu bewältigen.
Abb. 40: Hans R. Herren mit seinem «Team der Frühzeit»: Peter Neuenschwander in der Mitte und Kim Lema, rechts. Nigeria, 1981.
Mit viel Überzeugung und Arbeit ist es mir dann gelungen, die Mittel zu beschaffen und ein Team aufzubauen. Es waren bis 32 Wissenschafter auf vier Kontinenten am Forschungs-Programm beteiligt. Nach einem Jahr hatten wir die Schmierlaus und deren natürlichen Feind in Paraguay, Bolivien und Brasilien gefunden. Die Nützlinge (eine ganz spezifische Schlupfwespenart) wurden zuerst einmal von Südamerika nach England in ein Quarantäne-Labor zur gründlichen Unter-suchung eingeliefert. Nach etwa sechs bis acht Monaten wurden diejenigen Nützlinge, die alle Sicherheitstests überstanden hatten, nach Afrika in unsere Labors und Zuchtstätten aufgenommen — zu weiteren Studien und zur Massenvermehrung.
Die nächsten Schritte sind «history», wie man sagt. Wir haben die Nützlinge kreuz und quer über den Maniokgürtel Afrikas verbreitet, vom Boden und vor allem vom Flugzeug aus wurden sie in den Maniokfeldern freigelassen. Die Nütz-linge haben sich in 24 Ländern angesiedelt und die Schmierlaus total und überall unter Kontrolle gebracht. Innerhalb von 12 Jahren hat das Programm ein Gebiet, das anderthalb mal so gross ist wie die USA, abgedeckt. Die Kosten waren, alles inbegriffen, 20 Millionen Dollar, und es wurde geschätzt, dass etwa 20 Millionen Menschenleben gerettet wurden. Das Kosten-Nutzen Verhältnis wurde errechnet: mit 1 zu 247, über 20 Jahre, ist dieses für ein Entwicklungsprojekt einmalig. Das überaus erfreuliche Resultat ist eindeutig den Eigenschaften der biologischen Schädlingsbekämpfung zuzuschreiben — weil sie nachhaltig ist. Dass wir dank diesem Ansatz dann auch keine Chemikalien einsetzten und so die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt geschont haben, ist in der oben genannten Rechnung nicht einmal berücksichtigt.
Das Faktum, dass wir ohne Chemie und so mit der Natur das Problem lösen konnten, ist sehr wichtig als Beispiel für andere, ähnlich gelagerte Probleme. Es ist vor allem auch ein Hinweis dafür, dass wir die Biodiversität schützen müssen. Denn wir können nie wissen, wann wir sie brauchen, um andere ähnliche Probleme zu lösen. Das eingangs erwähnte Beispiel, «Push-Pull», basiert übrigens auch auf der schlauen Nutzung dieser Biodiversität.
Zurück zu «Push-Pull» in der Entwicklungszusammenarbeit: Was in Maniok- oder Maisfeldern funktioniert, bleibt auch auf übergeordneter Ebene und in grösseren Zusammenhängen gültig. Wenn wir die Entwicklung der armen Länder vorantreiben wollen, brauchen wir Leute, die von unten her stossen, und solche, die von oben her ziehen. Wir brauchen Organisationen wie Biovision, die mit lokal verankerten Projekten die Menschen vor Ort unterstützen. Wir brauchen engagierte Kämpferinnen und Kämpfer, die an den Fortschritt in kleinen Schritten glauben. Und wir brauchen einfache, aber effiziente Methoden und Technologien, die in Afrika wirklich angewendet werden können.
Als Naturwissenschaftler bin ich ein vehementer Befürworter von systemorientierten, wissenschaftlich abgestützten Lösungen. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass wir ohne politische und ökonomische Regelungen nicht weiter kommen. Wenn wir den armen Ländern eine Chance geben wollen, müssen wir ihnen erlauben, ihre Produkte zu exportieren. Dazu müssen die unfairen Handelsbarrieren beseitigt werden, welche die armen Länder behindern. Afrikanische Staaten müssen — genau wie vor ihnen China, Korea oder Indien — geschützt werden, bis sie bereit sind, in den globalisierten Markt einzutreten.
Als Direktor des Internationalen Insektenforschungsinstituts ICIPE und als Präsident der Schweizer Stiftung Biovision ist es mir heute möglich, beide Sichtweisen — diejenige von oben und die von unten — zu kombinieren und angepasst auf die jeweilige Situation umzusetzen. Die Erfahrungen, die ich damit mache, bestärken mich in meiner Überzeugung, dass «Push-Pull» im politischen Umfeld helfen kann, die Armut in dieser Welt zu vermindern.
Wenn man unsere Welt heute betrachtet, dominieren leider die gravierenden Probleme unserer Zeit. Das Klima gerät aus den Fugen, die Energieressourcen schrumpfen, riesige Nationen streben nach unserem westlichen, verschwenderischen Lebensstil, und noch immer sind ganze Kontinente von Hunger und Armut bedroht. Dass man angesichts dieser Weltlage eine pessimistische, ja sogar passive Haltung einnehmen kann, ist nachvollziehbar. Für mich ist aber klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als sich diesen Herausforderungen zu stellen und die Probleme aktiv anzugehen. Darum bleibe ich meiner Vision einer besseren Welt treu und führe den Kampf fort; sei das nun beruflich auf einer übergeordneten und internationalen Ebene oder sei es vor Ort mit konkreten, ökologischen Afrika-Projekten der Stiftung Biovision. Dabei darf ich glücklicherweise auf eine breite Unterstützung aus der Schweiz zählen. Dazu gehört natürlich auch die Brandenberger-Stiftung und die heutige Ehrung. Daraus kann ich Mut und Kraft schöpfen für meine Arbeit.
Ich bin ein Optimist und glaube nach wie vor an eine bessere Zukunft für die Welt. Dabei setze ich meine Hoffnungen insbesondere auch in die Jugend. Ich sehe mit Faszination, wie junge Menschen Ihre Energie in weltumspannendes Denken und zukunftsträchtige Technologien stecken.
Die Welt, in der wir leben, verändert sich durch unsere Aktivitäten positiv und negativ, und wer nicht ein Teil der Lösung wird, wird ein Teil des Problems. Veränderung ist spannend und überlebenswichtig! Genau hier haben die jungen Menschen ein ungeheures Potenzial, denn Veränderung ist ihre Leidenschaft. So hoffe ich, dass die Jugend das Zepter übernimmt und die Wende für eine bessere Welt auf ihre erfrischende Art und mit ihren eigenen Mitteln anpackt. Wir Alten sollten sie darin unterstützen — ich jedenfalls bleibe dran und mache weiter! — Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!