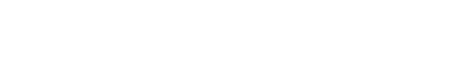1999 Toni Rüttimann

Geboren am 21. August 1967 in Pontresina. Am Tag nach der Matura 1987 reist Toni Rüttimann nach Ecuador, das eben von einem Erdbeben erschüttert wurde. Seither konstruiert er mit einfachsten Mitteln und aus Abfällen der Erdölindustrie, die er geschenkt erhält, Brücken. Bis heute hat er mit der einheimischen Bevölkerung, zuerst vor allem in Ecuador, später auch in Kolumbien, Honduras und Nicaragua, über 140 Brücken gebaut. Die längste Brücke weist eine Spannweite von 264 m auf.
In Anerkennung seiner menschenverbindenen Brückenbauten als «Toni EI Suizo».
Laudatio
Ruth Reusser
«Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei.» Diesen Satz von Marie von Ebner-Eschenbach möchte ich als Leitmotiv der Geschichte voranstellen, die im Zentrum unserer heutigen Feierstunde steht und die fast etwas Märchenhaftes hat:
Es war einmal eine Tochter, die zur Erinnerung an ihren Vater eine Stiftung errichtete. Diese Stiftung will, um die Worte des Präsidenten der Preiskommission zu gebrauchen, fördern und Gutes tun aus der Überzeugung, dass dieses Gute verdient, zum Wohle des Menschen weiterentwickelt und gefördert zu werden.
Und es war einmal ein Stiftungsrat, der stellte sich die Aufgabe, im Jahr 1999 eine Person auszuzeichnen, die den Stiftungszweck erfüllt, das heisst sich mit grösstem Einsatz ihrer Person ohne Schonung ihrer Kräfte um das Wohl der Menschheit besonders verdient gemacht hat und gleichzeitig — und das ist das Besondere am Preis des Jahres 1999 — durch ihr Wirken und ihren Einsatz im Ausland zur Verbesserung des Ansehens der Schweiz in der Welt beiträgt.
Schliesslich war einmal ein schweizerischer Botschafter in Ecuador, der — unterstützt vom schweizerischen Geschäftsträger in Houston —der Stiftung eine Dokumentation über den, wie er schrieb, zur Zeit besten schweizerischen Botschafter in Lateinamerika zustellte. Dieser beste Botschafter gehörte nicht — wie man es hätte erwarten können — dem diplomatischen Corps an. Vielmehr handelt es sich um einen jungen Mann namens Beat Anton Rüttimann, geboren am 21. August 1967, somit 32 Lenze jung, aufgewachsen im Engadin. Dieser junge Mann hat nach der Matur — seiner inneren Stimme folgend — seinen Wunsch verwirklicht zu helfen. Seit 12 Jahren ist er nun in Lateinamerika erfolgreich zugunsten der von Umweltkatastrophen gebeutelten armen Menschen tätig; er baut Brücken und ist als Toni el Suizo weitherum bekannt geworden.
Die erwähnte Dokumentation des schweizerischen Botschafters in Ecuador, ergänzt durch weitere Unterlagen, überzeugte Preiskommission und Stiftungsrat, so dass dieser junge Mann zum Preisträger 1999 gewählt wurde. Er ist der zehnte Preisträger der Stiftung und gleichzeitig der jüngste. Mit anderen Worten ist mit dieser Wahl das Durchschnittsalter der Preisträger der Stiftung Brandenberger auf einen Schlag beachtlich gesenkt worden. Das freut natürlich ganz besonders, ist aber keineswegs selbstverständlich, muss doch nach der Stiftungsurkunde ein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Der Preis verdient derjenige, der sich ohne Schonung seiner Kräfte als Lebensaufgabe für eine gute Sache einsetzt, sich als Person in die Schanze schlägt. Aufgabe dieser Laudatio ist es deshalb, darzustellen, was diesen jungen Mann so auszeichnet, dass ihm heute im Alter von 32 Jahren einer der grössten Preise, die in der Schweiz verliehen werden, überreicht wird.
Ob Sie, lieber Toni, sich allerdings gerne im Zentrum einer Laudatio, einer Lobesrede sehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Denn von verschiedenen Leuten, die Sie kennen, wird immer wieder Ihre Bescheidenheit, Ihr Wille zur Bescheidenheit betont. Nehmen Sie diese kurze Rede deshalb als Ausdruck einer ehrlichen Begeisterung, einer Freude von Menschen darüber, dass es Sie gibt. Und ansteckende Begeisterung wollen Sie ja mit dem, was Sie tun, auch erwecken.
Paulo Coelho, brasilianischer Nobelpreisträger für Literatur, hat in seinem weltberühmten Märchen «Der Alchimist», geschrieben: «Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, den persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Alles in Einem. Und wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das gesamte Universum dazu beitragen, dass du es auch erreichst.» Paulo Coelho hat Toni eI Suizo nicht gekannt. Mit seinen Worten hat er aber genau das beschrieben, was Toni el Suizo getan hat. Gestatten Sie mir, seine Geschichte noch einmal kurz Revue passieren zu lassen: Einige Tage nach seiner Matur im Frühling 1987 sah Toni im Fernsehen Bilder über die Auswirkungen eines starken Erdbebens in Ecuador. Das bewegte ihn, mit rasch zusammengesammeltem Geld in dieses Land zu reisen, in der Hoffnung vor Ort etwas Nützliches zu tun. Nur wenig Spanisch sprechend, machte er sich auf den Weg. Im Erdbebengebiet traf er auf einen holländischen Ingenieur. Angesichts der vielen zerstörten Brücken war für beide klar, dass der Bau von Brücken die dringendste Aufgabe war. Tausende von Personen waren isoliert, waren in ihrer Existenz gefährdet. So schaute Toni zu, wie der Ingenieur eine Brücke baute, aus Holz übrigens, und eine zweite Brücke anfing, die dann von Toni, ohne je dafür eine Ausbildung genossen zu haben, fertiggestellt wurde. Zurück in der Schweiz wurde ihm klar, dass er auf das geplante Studium verzichten wollte, auch wenn das von vielen nicht verstanden wurde. Er kehrte nach Südamerika zurück und widmete sich fortan dem Brückenbau.
In den kommenden Jahren hat er einige Rück-schläge einstecken müssen, einige Male sein Leben riskiert, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, Wunden abbekommen und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Das Brückenbauen ist inzwischen für ihn und seit acht Jahren auch für seinen Freund und Weggefährten, den einheimischen Schweisser Walter Janez, zum Beruf und zur Lebensaufgabe geworden. Die beiden haben ihren Traum vom Helfen erfolgreich umgesetzt, jeden Tag immer wieder neu, mit unbändigem Willen und riesigem Einsatz ihrer Kräfte, ohne Schonung ihrer Person, gegen Widerwärtigkeiten kämpfend, im Schlamm stehend, von Moskitos zerstochen, auf hohen Seilen balancierend, den Schwindel überwindend. Wo immer sich eine Naturkatastrophe erreignet, wo immer eine Brücke gebraucht wird, die beiden sind zur tatkräftigen Hilfe bereit.
Rund 120 Brücken sind es in 12 Jahren geworden, Brücken, die in verschiedenen Ländern Südamerikas stehen, Brücken, die zu einem grossen Teil mit den Farben Rot und Weiss angestrichen worden sind, Rot als Farbe der Liebe, Weiss als Farbe der Ehrlichkeit, gleichzeitig aber auch mit dem Namen Toni eI Suizo verbunden und damit ein Symbol für die Schweiz.
Unser Preisträger zeichnet aber nicht nur Hartnäckigkeit, Kraft, Mut und Glauben an das Gute aus, sondern festzustellen ist auch ein bemerkenswertes Organisationstalent, das seine Aktionen erfolgreich macht.
1994 initiierte er nach dem schrecklichen Erd-beben im Süden Kolumbiens die erste spektakuläre gemeinsame Mission der ecuadorianischen, kolumbianischen und amerikanischen Luftwaffe. Kampfhelikopter transportierten über 130 km hinweg eine Brücke des Friedens. Ein weiteres Beispiel: Am 4. November 1998 haben die zwei Freunde beschlossen, eine Brücke, an der sie am Bauen waren, über Nacht fertigzustellen und helfen zu gehen in das Land, das vier Tage zuvor vom Hurricane Mitch verwüstet worden war. Eine Woche später kamen die beiden in Honduras an, mit 160 Tonnen an Röhren, Kabeln, Lastwagen und Geräten. Inzwischen sind 20 Brücken gebaut, 8 sind in Vorbereitung, weitere sollen es noch werden. Das Ganze ist eine Meisterleistung der Organisationskunst, aber auch Aus-druck des Helferwillens unzähliger weiterer Personen. Toni el Suizo ist somit nicht nur ein Mann des Überkleides, sondern auch ein Mann, der modernste Telekommunikation beherrscht und einzusetzen weiss, der sein Organisationstalent zur Entfaltung bringt, wo nötig das Überkleid mit dem Anzug vertauscht und erfolgreiche Bittgänge zu Ministerien und Managern von Weltkonzernen und grossen Firmen unternimmt und auch die Herzen des Militärs bewegen kann. Toni und sein Freund Walter stehen deshalb als Beispiel dafür, dass der Wille, zu helfen, ansteckend ist, dass die Begeisterung eines Menschen sich auf viele andere übertragen kann.
Was hat doch Paulo Coelho gesagt: «Wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das gesamte Universum dazu beitragen, dass du es auch er-reichst.» In der Tat steht hinter den beiden ein Heer von Helfern, in Lateinamerika, aber auch in der Schweiz — hier insbesondere die Eltern von Toni Rüttimann, aber auch seine weitere Familie und viele Freunde.
Die Brücken von Toni el Suizo und seinem Freund Walter machen im Leben von vielen Zehntausenden von Menschen einen wesentlichen Unterschied aus, sie schaffen Verbindungen, eröffnen den Weg zur Aussenwelt, zur medizinischen Versorgung, zu Handelsplätzen und zur Bildung. Sie sind damit für die Menschen von existenzieller Bedeutung. Gratis wird Brückenbauhilfe geleistet. Bedingung ist aber, dass die Einheimischen beim Bau das Ihre beitragen, mithelfen. Das entspricht einem pädagogischen Konzept und ist ein Beitrag im Kampf gegen Passivität, Lethargie und Unzuverlässigkeit.
Das Grundrezept des Brückenbauens von Toni, seinem kreativen Geist entsprungen, ist ebenso einfach wie überzeugend: man nehme den Ab-fall von anderen und mache daraus etwas Nützliches. Ausrangierte Pipeline-Röhren und Bohr-kabeln von Erdölgesellschaften und weiteres gespendetes Material werden zu Brücken umfunktioniert. Unter den vielen Brücken befindet sich eine, die die Wasserversorgung für eine Stadt mit 200'000 Menschen sicherstellt. Die längste Brücke, die Toni vor vielen Jahren gebaut hat, ist 262 m lang, einen Meter breit und hängt 30 m über dem Fluss. Ihr Bau erstreckte sich über zwei Jahre. Heute könnten Toni und Walter die gleiche Brücke in einigen wenigen Wochen bauen. Laufend haben sie ihre Erfahrungen ausgewertet, neue Ideen ausprobiert und ihre Technik verbessert. Die Lebensdauer der Brücken wird auf 20-30 Jahre geschätzt. Unser Preisträger ist somit auch mit einer guten Portion Erfindergeist ausgestattet. Der Brückenschlag zur Person, der unsere Stiftung gewidmet ist, liegt somit nahe. Dr. Brandenberger war ein erfolgreicher Erfinder, der junge Leute, die hartnäckig ein Ziel verfolgten, immer unterstützte, ihre Kreativität förderte und ihnen Freiräume gab, um ihre Ideen umzusetzen. Ich bin deshalb überzeugt davon, dass Dr. Brandenberger an unserem diesjährigen Preisträger seine ganz besondere Freude hätte. Denn wer will die Idee, aus Abfallmaterial Brücken herzustellen, nicht als genial bezeichnen. Im übrigen zwang ein schwerer Lastwagenunfall Toni vor einiger Zeit, sein Konzept des Brückenbauens zu überdenken. Mit staatlicher Hilfe wurde in verschiedenen Ländern Lateinamerikas die Voraussetzungen zur raschen Katastrophenhilfe geschaffen. Viele Kilometer von Abfallröhren und Bohrkabeln wurden zu vorfabrizierten Brückenelementen umgearbeitet, die auf verschiedenen Stützpunkten lagern — ein neuer Ansatz, der das Wirken der beiden Freunde noch erfolgreicher macht. Arbeit sehen die beiden für die nächsten 50 Jahre.
Lieber Toni el Suizo: Sie haben mit Ihrer Arbeit, mit Ihrem bedingungslosen Einsatz zugunsten der Ärmsten dieser Welt gezeigt, wozu Menschen fähig sein können, wenn sie an sich selber und an die ihnen vom Schöpfer mitgegebenen Anlagen glauben und diese kompromisslos und zielstrebig einsetzen. Dank Ihrem unermüdlichen Einsatz sind Sie Hoffnungsträger, Sinnbild der Menschlichkeit, der Humanität, der Liebe für den Nächsten in einer Zeit, in welcher der Individualismus, der Egoismus weit verbreitet ist. Sie zeigen mit Ihrer Arbeit und mit Ihrem Erfolg aber auch, dass Menschenliebe, Begeisterung für eine gute Sache ansteckend sein kann. Denn eines ist klar. Das, was geleistet worden ist, ist nicht einfach das Werk einer Einzelperson. Indem Sie aber Nächstenliebe vorleben, haben Sie die unterschiedlichsten Menschen zur gemeinsamen Hilfe für viele Menschen zu bündeln vermocht. Sie stellen deshalb mit Ihrer Person selber eine Brücke dar zwischen Ihrer Heimat und Lateinamerika, eine Brücke zu Weltkonzernen und anderen Gesellschaften, aber auch zu politischen und militärischen Instanzen, die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit in dieser oder anderer Form Unterstützung gewähren.
Wir freuen uns sehr, dass Ihnen heute der Brandenbergerpreis 1999 überreicht wird, und wir gratulieren Ihnen von ganzem Herzen dazu. Mit der Verleihung des Brandenbergerpreises an Sie wird auch all den Menschen, die Sie mit Ihrem Helferwillen anstecken und die Sie unterstützen, gedankt.
Die heutige Ehrung wird Ihnen aber auch in der Hoffnung zuteil, dass Sie weitermachen, Ihr inneres Feuer, Ihren Mut, Ihre Kraft, Ihren Willen, Gutes zu tun, nicht verlieren. Bleiben Sie der Mann mit dem grossen Herzen, der Mann mit dem unbändigen Willen, der kreative Geist, der Mann mit dem Glauben, dass Gott ihm die Kraft gibt, Berge zu versetzen. Wir alle wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebensweg. Vielleicht noch ein letztes: Sie haben das Glück, dank Ihrer Tätigkeit, dank Ihrem Einsatz für das Gute, ein zufriedener Mensch zu sein. Bewahren Sie sich dieses Glück. und bewahren Sie sich Ihr Lachen und Ihren Humor, trotz des Düsteren, das es auf dieser Welt gibt.
Erinnerungen
Toni Rüttimann
Ecuador 1987
In der Katastrophenzone von Ecuador kam Toni el Suizo auf die Welt. Ich dachte, ich hätte schon genug geleistet damit, dass ich im Oberengadin 9'000 Schweizerfranken gesammelt und mich in der Nacht meines Maturaabschlusses in Richtung erdbebenzerstörtes Ecuador aufgemacht hatte, um das Geld persönlich einzusetzen. Welch eine Illusion, helfen zu können, als 19¬jähriger Schweizer, der keine Ahnung hatte, und nicht einmal Spanisch sprach.
Die Wirklichkeit traf mich mit voller Wucht. Nichts hatte mich vorbereitet auf soviel Chaos und Zerstörung, auf die Isolation und die Distanzen. Es ist eine Sache, die Bilder über eine Katastrophe auf dem Fernsehschirm zu sehen, und eine andere, sich mitten in ihnen zu bewegen. Ganze Dörfer waren noch immer hinter den tobenden Flüssen abgeschnitten. Endlos zogen Familien mit ihrem Hab und Gut in Bündeln zu Fuss durch das Land, auf der Suche nach einem neuen Leben. Weinende Kinder standen in den Ruinen entlang des Weges, verloren in ihrer Trostlosigkeit. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich soviel Leiden sah.
Es war auch das erste Mal, dass ich begriff, was es bedeutet, keine Brücke zu haben. In meiner Heimat, da kann man aufwachsen, ohne sich während 19 Jahren ein einziges Mal zu fragen: «Was wäre ohne eine Brücke?». Die Brücken überquert man einfach. Eindrückliche, technisch einwandfreie, kunstvolle Brücken. Doch hier in Ecuador sah ich Menschen heulen vor Verzweiflung, weil sie nicht einmal ein Seil besassen, um sich in Freiheit zu hangeln.
Ich hatte Glück. Etwa in der zweiten Woche meines Herumstolperns in der Gegend traf ich auf einen holländischen Ingenieur, der seine Arbeit in der Hauptstadt zurückgelassen hatte um zu sehen, was er in der Katastrophenzone helfen könnte. Er wusste von einem Ort, wo man mit einer 50-Meter-Hängebrücke mehrere Hundert Campesinos tragen markierte Hauptträgerkabel der Brücke Nr.119, Yoro, Honduras.
Menschen befreien könnte, doch das Geld fehlte. Ich hatte das Geld und wusste nicht wie helfen. Zusammen mit der Bevölkerung bauten wir die Brücke. Es wurde eine etwas schräge Brücke, aber es war eine Brücke. Wir begannen noch eine zweite Brücke, die der ecuadorianische Helfer des Ingenieurs fertig bauen sollte.
Nach sechs Monaten war ich zurück in der Schweiz, rechtzeitig, um das Bauingenieur-studium zu beginnen. «Als Ingenieur kannst du dann wirklich helfen», so machte ich mir Mut. Und ich studierte. Doch nachts, alleine in meinem Zimmer, kamen die Bilder aus Ecuador zurück: die verlorenen Kinder und die Schreienden am Flussufer. Während sechs Wochen stand ich jeden Morgen vor der ETH und fragte mich: «Hier willst du nun fünf Jahre lang studieren? Du wirst dich an all die Annehmlichkeiten gewöhnen: dreimal täglich gute Mahlzeiten, ein schönes Zuhause, Freunde, Freundin, Sport, Ferien. Und dann, nach langen fünf Jahren, wirst du dann noch entschlossen genug sein, um zu sagen: Ja, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich den Armen helfen.»
Am Ende der sechsten Woche entschied ich mich. Ich war bereit, meinem Traum zu folgen, wo auch immer er mich hinführen würde. Ich war entschlossen, zu einer besseren Welt beizutragen, wie auch immer das sein würde. Ich meldete mich bei der ETH ab, verabschiedete mich von Freunden und Familie, leerte mein Sparkonto und ging zurück zu den Armen nach Ecuador.
Ecuador 1989
Jesús Rodriguez sass ruhig neben mir auf dem Baumstamm am Rand des Regenwaldes. 30 Meter unter uns floss der riesige Rio Aguarico in Richtung Amazonas. Über das letzte Jahr hinweg hatte dieser braungebrannte Halbindianer mir beigebracht, in Armut zu leben. Wir hatten uns an der zweiten Brücke getroffen, an jener, die ich bei meiner Rückkehr nach Ecuador nur halbfertig vorgefunden hatte. Zusammen hatten wir diese 80-Meter-Brücke «fertig gebastelt». Monate später, nachdem ich mich von meiner ersten Malaria erholt hatte und die mexikanischen Missionarinnen mich wieder ziehen liessen, suchte ich ihn wieder auf und fragte ihn: «Jesús, willst du mit mir kommen? In El Nazareno brauchen sie auch eine Brücke. Ich habe kein Geld mehr, und ich kann dich nicht bezahlen. Aber wir können von dem leben, was die Campesinos uns geben».
So gingen wir und bauten weit draussen im Dschungel eine dritte Brücke mit den Kabeln, die von der ersten und zweiten Brücke übrig geblieben waren. Wir benötigten Monate dafür, denn das war die erste Brücke, die wir selber bauten. Jesús war ein Meister im Dschungel und ein Meister der Armut. Von ihm lernte ich, im Schlamm zu laufen, in den trügerischen Flüssen zu schwimmen, was zu essen, wenn es etwas gab, und auf dem Bretterboden zu schlafen. Er war ein Peón, ein Landarbeiter angestellt bei einem Landarbeiter, das unterste Glied der Kette. Sein Beruf war, das Dickicht mit der Machete umzuhauen und Kaffee zu sammeln. Seine Hände waren stark, seine Finger vernarbt und verkrümmt. Er war noch keine dreissig, wenn er auch nicht genau wusste, wie alt er war, denn seine Mutter war bei seiner Geburt gestorben, und sein Vater war nie aufgetaucht. Als kleiner Waise war er aus Kolumbien durch den Dschungel über die Grenze nach Lago Agrio gekommen. Keinen einzigen Tag in seinem Leben war er zur Schule gegangen, zittrig schreiben hatte er selber gelernt. Er war mutig und lustig. Er war mein Lehrer und Freund. Und: er glaubte an meinen Traum von der Brücke.
Auf der anderen Flussseite, ebensohoch über dem Fluss, standen in einer Reihe am Dorfrand die Indianer. Über die fast 300 Meter Distanz waren nicht einmal ihre Körper recht erkennbar, doch es waren über hundert Leute. Ihr Anführer Puma Changa, die Tigerpranke, war schon mit dem Kanu auf dem Weg zu uns, um unsere Antwort zu hören. Hoffnungsvoll setzte er sich Jesús und mir gegenüber und fragte: «Nun, Toni, was wird es sein: eine Brücke oder keine Brücke?»
Ich antwortete: «Puma, ich weiss nicht, wie man so eine Brücke baut. Jesus und ich haben bis jetzt nur eineinhalb kleine Brücken gebaut. In Wahrheit wissen wir nicht, wie es geht. Und hier reden wir von 270 Metern Spannweite! Wir haben kein Geld, kein Werkzeug, kein Material und nicht einmal ein Kabel. Kein Ingenieur will überhaupt eine solche Brücke entwerfen. Alle, die ich gefragt habe, sagen mir, ich spinne.» «Aber... wirst du es versuchen?»
«Ja, wir geben nicht auf. Wir wollen euch helfen, aber es kann lange dauern. Werden deine Leute arbeiten?»
«Alle wollen die Brücke. Auch die anderen In-dianer und die Siedler. Es sind elf Dörfer, Toni! Enttäusche uns nicht!»
Zwei Tage später waren wir im Ölfeld Los Lobos, weit im Dschungel hinter dem Ölstädtchen El Coca. Wir hatten uns auf eine Anhöhe herangepirscht, von wo aus wir zum ersten Mal einen dröhnenden und stampfenden Bohrturm erblickten. Wir wussten nicht einmal, wie wir uns verhalten sollten, und ob es überhaupt erlaubt war, das Camp zu betreten. Schliesslich machten wir Bekanntschaft mit dem Camp-Koch und erzählten ihm von unserem Vorhaben, eine 270 Meter lange Hängebrücke zu bauen, und dass wir altes Bohrkabel dafür suchten. Der Koch verpflegte uns zuerst und schickte uns dann lachend zum Supervisor. Der Supervisor runzelte nur seine Stirn und sandte uns 110 km zurück nach Shushufindi ins Base Camp der Bohr-gesellschaft. Der Superintendent dort schaute uns mitleidig von oben bis unten an: in billigen Jeans und noch billigeren Venus-Turnschuhen standen wir vor ihm. Er sandte uns zum Landes-manager in die Hauptstadt. Für uns, ohne Geld und ohne schöne Kleider, war eine Reise nach Quito schon ein grösseres Unterfangen. Dort wollte mich die Chefsekretärin mit meinem handgeschriebenen Bettelbrief nicht zum General Manager durchlassen. So verliess ich halt das Gebäude wieder und kam zurück mit einem Strauss Blumen für sie. Am nächsten Tag machte der General Manager, Mr. Glenn Frantzen, die Sache kurz: «Ich habe mir nicht die Zeit genommen, deine 15 Seiten Testament zu lesen. Aber du kannst das Kabel haben.»
Etwas ausserhalb Ecuadors Erdölhauptstädtchen Lago Agrio existieren nebeneinander zwei 270 Meter lange Hängebrücken. An ihnen aufgehängt, überquert die Pipeline mit einem Grossteil der nationalen Erdölproduktion den Rio Aguarico. Unter diesen Hängebrücken habe ich beobachtend, zählend und messend unzählige Stunden verbracht. Der Mexicaner Al Diaz, Chefingenieur von Texacos Special Projects Department in Lago Agrio, unter dessen Aufsicht diese Hängebrücken gebaut worden waren, bot schliesslich eine Chance: «Na gut, ich helfe dir mit dem Entwurf. Aber pass auf, Toni el Suizo», lachte er, «pass auf, dass dir nicht dasselbe passiert wie dem Zorba el Griego!»
Im Film von Nikos Katzantzakis wollte Zorba auch eine Art Brücke bauen, ohne aber eine blasse Ahnung zu haben. Bei der Einweihung krachte alles zusammen. Doch anstatt am Bo-den zerstört zu sein, stand Zorba auf, nahm seinen Partner beim Arm und begann, seinen berühmten Tanz zu tanzen. Aber im wirklichen Leben ist es ernster: Wie kann man garantieren, dass so eine Brücke standhält? Zuerst einmal, indem man alles überdimensioniert.
«Wir brauchen mindestens Zehnzollröhren für die pilotierten Fundamente und die Trägerstrukturen. 144 Meter davon. Kannst du das kriegen?» fragte Al Diaz.
«Ich werde suchen.»
Ein paar Tage später erhielt ich Zutritt zu seinem Chef Tom Crawford. Der Texaco-Superintendent für Amazonien schaute gutmütig, aber etwas mitleidig durch seine dünnrandige Brille über seinen Schreibtisch.
«Du musst wissen, dass ich keine einzige Schraube weggeben kann, ohne dass unsere Partner im Konsortium es autorisiert. Wenn du dich durch ihre Bürokratie kämpfen willst und sie überzeugst, dann werde auch ich meine Unterschrift daruntersetzen.»
«Glauben Sie, dass ich eine Chance habe?»
Er lehnte sich in seinem Sessel zurück, liess seine Hosenträger auf seinen dicken Bauch knallen und meinte mit einem breiten grossväterlichen Grinsen: «Go for it, tiger!»
Sechs Monate später hatte ich die Röhren. Ich brauchte ein weiteres halbes Jahr, um von 24 verschiedenen Ölgesellschaften das restliche Material zusammenzubetteln. Wir mussten auch eine kleine Strasse von der staubigen Haupt-strasse bis hinunter zur Brücke bauen, um überhaupt mit den schweren Pipeline-Röhren und den Maschinen an den Bauort zu gelangen. Weiter mussten wir im 43 km entfernten Lago Agrio Schweissequipen suchen, welche uns an Freitagen oder Wochenenden die Türme und Ankerteile schweissen würden. Die riesigen Ausgrabungen machten die Bewohner von Hand. Den Zement suchten Jesús und ich bei Zementierfirmen zusammen. So erlaubte uns die BJ Hughes, in ihre Zementsilos zu klettern und darin Tonnen und Tonnen von Zement in alten Kaffeesäcken zusammenzukratzen. Hal liburton machte es uns eines Tages sehr viel einfacher: Sie schickten uns gratis und franko einen Sattelschlepper mit 400 neuen Säcken Zement direkt zur Brücke. Und auch die von der schweizerischen Holderbank abhängige Cemento Nacional in Guayaquil am anderen Ende des Landes sandte uns 400 Säcke Zement. Im ganzen verarbeiteten die Indianer bei der Brücke über 1200 Säcke Zement, also 60 Tonnen. Dafür mussten sie aber zuerst monatelang den Kies, den Sand und die Steine vom Fluss auf die beidseitigen Anhöhen tragen. Insgesamt 800 Tonnen Steinmaterial, alles in Säcken und Körben auf den Rücken von Männern, Frauen und Kindern, also etwa 40'000 Reisen mit 20 kg Durchschnittsladung. Und dann, während Wochen Beton mischen: nochmals die 800 Tonnen Steinmaterial verschieben, mit 70 Tonnen Zement und 40'000 Litern Wasser mischen, alles von Hand, mit Schaufel und Pickel, ohne einen einzigen Zementmischer oder eine sonstige Maschine. Angetrieben von meiner Angst, dass die Hauptverankerungsblöcke nicht zuverlässig halten würden, wenn wir nicht einen einzigen nahtlosen Klotz gössen, hielten die armen Indianer und Siedler pro Block drei Tage und drei Nächte durch. Wir hatten drei Gruppen gebildet, die sich jeweils nach acht Stunden ablösten. Die Frauen brachten Essen, das sie in ihren riesigen Gemeinschaftskübeln kochten. Das waren Kochbananensuppen, oder sonst Mehlfladen. Zum Trinken gab es erfrischende, schwach alkoholhaltige Chicha aus dem Wurzelgewächs Yuca. In den endlosen und kühlen Nächten brachten sie Wasser mit Guayusa-Blättern, eine Pflanze, die ähnlich wie Kaffee anregend und kräftigend wirkt. Bis heute ist meinen Ohren unvergesslich geblieben jenes konstante «Schiikschak, Schiikschak» der Schaufeln, die in den Betonhaufen fahren und ihn Stück für Stück mischen. Noch heute staune ich, dass Menschen, die nicht einmal Geld hatten, um Nahrungsmittel zu kaufen, sich zusammenschlossen und von Hand ihren Traum erbauten, Stück für Stück, Tag für Tag, über zwei lange Jahre hinweg.
Jesús und ich hatten ebensowenig Geld. Wir wohnten in einer selbstgebastelten Holzhütte auf der gegenüberliegenden Seite des Indianerdorfes, hoch über dem Fluss. Während der Regenzeit prasselte der Regen auf die alten Wellbleche, und der Wind zerrte an den Hüttenwänden. Es war schon unangenehm aufzuwachen, weil die Regentropfen ihren Weg direkt vom Hüttendach in meine Koje fanden. Doch unsere sehr seltenen Besucher fanden es noch unangenehmer, dass wir zwei Taranteln in ihren weichen weissen Nestern an den Hüttenwänden hausen liessen. Diese räumten mit den Mos-quitos und Cucarachas auf. Oft fand man morgens nur noch die trockenen Flügel der zehn Zentimeter langen Riesencucarachas. Wir assen wenig Gemüse, da bei der tropischen Hitze alles Gemüse innerhalb von wenigen Stunden schlapp wurde. Am besten hielt sich noch der Kohl. Manchmal konnten wir ein gigantisches Schauspiel beobachten: Eine Armee von Wanderameisen demontierte in weniger als 24 Stunden einen gesamten Kohl und transportierte ihn irgendwohin in den Dschungel. Die Indianer brachten uns von der anderen Seite, was sie teilen konnten: Kochbananen, süsse Bananen, Dschungelfrüchte, Fische. Während Wochen war die einzige Nahrung, welche wir kaufen mussten, Öl und Salz. Wenn wir unterwegs auf Materialsuche waren, waren Jesús und ich bekannt dafür, mit einem Sack Brot und Karotten aufzutauchen. Wir dachten, dass wir so wenigstens das nötige Vitamin A erhielten. Wir lebten einfach, und doch mussten wir kräftig sein: Nach eineinhalb Jahren Arbeit an der Brücke ging es endlich darum, auf die Hauptkabel zu klettern und die fast hundert einzelnen Hänger-kabel mit Querträgern zu befestigen. Wir erfanden ein eigenes Montagesystem, das so kriminell war, dass nur Jesús und ich uns wagten raufzuklettern. Wochenlang baumelten wir so in bis zu 40 Meter über dem Fluss. Es war während jener Zeit, dass ein Kameramann vom ecuadorianischen Fernsehen uns entdeckte. Wir luden ihn auf unsere noch recht sichere Startplattform auf dem Brückenpfeiler ein. Nachdem er sich vom Zittern und einem Weinkrampf erholt hatte, fragte er Jesús, was es denn dazu brauchte, um hier zu arbeiten.
Jesus antwortete ihm: «Nun, man muss etwas geschickt sein, und man muss sich für die anderen einsetzen wollen. Und mir gefällt es, etwas Kapriolen zu machen.»
Nach zwei langen Jahren kniete ich eines Mor-gens auf der Anhöhe und schaute auf die Brücke runter. Es war der Tag der Einweihung. Der Bischof war angereist, um die Brücke zu segnen, zusammen mit Al Diaz und all den anderen Managern und Arbeitern von Firmen, die mitgeholfen hatten. Die Indianer hatten während einer Woche im Dschungel gejagt, um das Festessen mit Fisch und Affen, Guatusas, Guantas und Dantas für all die Eingeladenen zusammenzubringen. Der Militärkommandant von Santa Cecilia hatte für die ecuadorianische Nationalhymne zu Beginn der Zeremonie die Musikanlage mitgebracht. Und dann, zum Abschluss, tönte in ganzer Wucht «Zorba's Dance» über den Rio Aguarico. Mit Jesús Rodriguez an meiner Seite, mit der Hand auf der Brust, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Durch die Tränen schaute ich hinüber zur Ehrenbank: Al Diaz lächelte zurück und nickte hin zur Brücke.
Ecuador 1992
Bei meinem folgenden Besuch in der Schweiz bekam ich von Freunden aus dem Engadin eine alte Schweissmaschine und anderes nötiges Werkzeug geschenkt, sogar zwei Lastwagen waren dabei. Damit konnte ich unser System über die nächsten Jahre hinweg etwas verbessern und vereinfachen. Meine innere Stimme, auf die ich unterdessen zu hören und vertrauen gelernt hatte, trieb mich weiter, den Brückenbau für die Armen auf ganz Ecuador auszuweiten. Jesús, mein Partner der ersten Jahre, wollte und konnte nicht mitziehen, da er Frau und unterdessen fünf Kinder hatte. So kam es, dass ich ab 1992 mit Walter Yänez durch das Land zog. Walter war ein Schweisser und Mechaniker aus dem Erdölstädtchen Lago Agrio in Ecuadors Amazonien, den ich schon seit langem kannte. Erst 1992, nach einem schweren Schicksalsschlag, war er bereit, alles zurückzulassen und mich zu begleiten. Er verkaufte sein Hab und Gut, verabschiedete sich von allen und packte seine Habseligkeiten in zwei Taschen. Als wir am dritten Tag unterwegs waren, wurden seine beiden Taschen aus unserem Lastwagen gestohlen. Walter Yänez begann sein neues Leben als Brückenbauer mit den Kleidern, die er auf dem Leibe trug.
Ecuador 1998
Mit unseren zwei voll beladenen Lastwagen kamen Walter und ich in der Stadt Portoviejo an, der Hauptstadt der Provinz Manabi. Schon seit über sechs Monaten litten die Menschen in die-ser Provinz unter Überflutungen nach den Re-genfällen, die El Nifio brachte. Das Strassennetz war komplett zerstört, und die gesamte Provinz war vom Rest des Landes praktisch abgeschnitten. Doch die Stadt Portoviejo mit ihren mehr als 200'000 Bewohnern und Dutzende von Dörfern ringsum erlebten einen zusätzlichen Alptraum: Seit über zwei Monaten war die Wasserversorgung unterbrochen. Es gab kein Trinkwasser, kein Wasser zum Kochen, kein Wasser zum Duschen, kein Wasser für die Toilette, kein Wasser zum Kleiderwaschen. Wo immer man hinsah, sahen wir Menschen mit Plastikkanistern auf dem Gehsteig, Kinder, die schwere Behälter schleppten, Taxis, Pickups, Dreiräder und sogar Esel, beladen mit Wasserfässern. Zum Glück fiel alle paar Tage wieder etwas Regen, und die glücklichen Besitzer eines eigenen Daches konnten in allen möglichen Behältern Wasser sammeln. Manchmal hiess das, morgens um drei Uhr aufstehen und einen Behälter nach dem anderen unter den Dachkanal schieben, um ja keinen Tropfen des so wertvollen Nass, das vom Himmel fiel, zu verlieren. Andere hatten in ihrer Verzweiflung begonnen, im Hinterhof ihre eigenen kleinen Brunnen zu graben und so das Grundwasser der Stadt anzuzapfen. Dies zog je-doch eine schreckliche Folge nach sich: Die Cholera begann sich in Portoviejo auszubreiten. Sie kam zum Dengue-Fieber und zur Leptospirosis hinzu, die durch den faulenden Schlamm und die stehenden Wasser ausgelöst wurden.
In diese Stadt gelangten wir also am späten Nachmittag des 10. Mai 1998, zum Bau unserer 93. Brücke. Zweieinhalb Tage zuvor, nach einer ermüdenden Baureihe von fünf Brücken in der Nähe von Quevedo, hatte im Lastwagen unser Mobiltelefon geklingelt:
«Tony, habla Rafael. Ich bin der Vizedirektor des Centro de Rehabilitaciön de Manabi. Unsere Wasser-Pipeline, die das Trinkwasser vom Poza-Honda-Staudamm nach Portoviejo führt, ist in der Mitte eines Flusses auseinander gebrochen. Die einzige Lösung ist, über den Fluss eine Hängebrücke für die Pipeline zu bauen. Können Sie uns helfen?»
«Ah... ahmmm, ja, von was für einer Spannweite und von welchem Röhrendurchmesser reden Sie?»
«Es sind etwa 60 Meter Spannweite, und 45 cm Röhrendurchmesser.»
Verzweifelt versuchte ich im Kopf die Ladungen und Spannungen auszurechnen. «Si, Serior», wagte ich es, «wir können helfen. Doch weshalb geben Sie nicht einen Auftrag an eine Konstruktions- oder Ingenieurfirma in Ihrer Provinz?» «Um die Wahrheit zu sagen: niemand will seinen Namen riskieren mit dieser Pipeline-Brücke, denn so etwas wurde hier noch nie gemacht. Weiter ist da der gewaltige Druck aus der verzweifelten Bevölkerung und von den Medien. Obendrein ist im Moment wegen der Abgeschnittenheit der Provinz kein Zement verfügbar. Die Leute fangen an, uns mit Steinen zu bewerfen, und sie werden bald unser Gebäude hier in Brand setzen. Wir haben weder das Geld noch die Zeit, eine alternative Linienführung zu bauen. Ich habe eure Hängebrücken in Santa Ana gesehen. Hier halten mich alle für verrückt, doch ich sage, dass die einzige Lösung eine Hängebrücke ist... Also, werden Sie uns helfen?» Wir benötigten einen halben Tag für den Weg nach Santo Domingo, um dort die zweitletzte unserer gelagerten Rettungsbrücken zu laden und unsere Nahrungsmittel- und Frischwasser-reserven aufzufüllen. Walter ging schnell bei seiner Frau und seinem Kind vorbei, und ich machte den wichtigen Telefonanruf zum einzigen Mann der Welt, der mich jetzt im Hinblick auf eine Pipeline-Brücke und auf deren spezifischen Gefahren beraten konnte:
«Bill Harbert Constructions, mit wem kann ich verbinden?»
«Mit Mr. Sol Lepp, bitte. Dies ist ein dringender Anruf aus Ecuador, Südamerika.»
Sol ist Harberts Vizepräsident für Lateinamerika, und in seinem Leben hat er Dutzende von grossen Hängebrücken für Öl-Pipelines über Flüsse in Südamerika und Afrika gebaut. Wir hatten uns in meiner ersten Woche in Ecuador kennengelernt. Seit damals blieb mir Sol ein grosszügiger Freund und Lehrer gewesen. Nun erklärte mir Sol innerhalb von zehn Minuten die kritischsten Punkte des Baus der geplanten Brücke und schloss mit den Worten: «Für 200'000 Menschen? Pass'nur auf, dass Du genug Reserve da drin hast, mein Freund!»
Dann begann für Walter und mich die verzweifelste und schrecklichste Lastwagenfahrt unseres ganzen Lebens: Zwei volle Tage über einen schlammigen Bergpfad, der von El Empalme über Pichincha nach Portoviejo führte und die letzte Landverbindung in die Provinz Manabi war. Die Fahrer der kleinen Lastwagen und mittelgrossen Busse, die uns entgegenkamen, waren überrascht, unsere zwei Lastwagen und die Anhängerkombination den Pfad beginnen zu sehen. Dutzende von ihnen winkten nur müde mit der Hand aus dem Fahrerfenster mit jener typischen Geste für «no hay paso, no hay paso». Ein Fahrer, mitleidig auf meinen zwanzig Meter langen Lastwagenzug zeigend, rief nur diese Worte durch den fallenden Regen: «Que Dios les ayude!» Es ist schon wahr: Es war eine Verrücktheit zu versuchen, einen neun Meter langen Anhänger mit unserer blauen Kiste und Küche über diese «Strasse» schleppen zu wollen. Doch Walter und ich wussten beide, dass es eine noch grössere Verrücktheit war, in dieser Hitze keinen eigenen Platz zum Schlafen, keine eigene Dusche und kein eigenes Wasser dabei zu haben. Schon unter normalen Umständen zehrt unsere Arbeit so an uns, dass es einen himmel-weiten Unterschied macht, ob man in seinem ei-genen Bett schläft oder nicht.
So sass ich nun auf dem Volvo, jeweils darauf wartend, dass alle vier Achsen und die 14 Räder vorwärts von Strassenloch zu Strassenloch schwankten, über Hindernisse hinweg und über Strassensperrenähnliche Hügel. Walter fuhr gleich hinter mir mit dem Hinolastwagen, der mit der grossen Rolle Hauptkabel und den voluminösen Bodenstrukturelementen ebenso unangenehm beladen war und mit denen wir vorhatten, die Wasser-Pipeline an Kabeln aufzuhängen. Unser Funkverkehr hatte sich auf ein Minimum reduziert, da jeder selber versuchte, mit der unglaublichen und heiklen Fahrerei fertig zu werden, und mit der Angst, unterwegs tatsächlich weder vor noch zurück zu können oder gar abzurutschen. Es war besser, nicht daran zu denken, was passieren würde, wenn einer unserer Lastwagen uns jetzt im Stich lassen würde. Es kann schrecklich einsam werden in so einer Fahrerkabine, nachts, im ununterbrochen fallenden Regen, auf einer Strasse, die im ganzen Land bekannt ist für ihre Banditen und Überfälle. Es muss so um neun Uhr nachts gewesen sein, nachdem wir schon 12 Stunden unterwegs waren, als Walters Stimme wie eine Bombe in meiner Kabine explodierte:
«Meine Ladung ist vom Laster gefallen!»
Ich versuchte, mich zurückzuhalten und nicht in das Mikrofon zu bellen, sondern manövrierte vorsichtig an den Rand, sicherte den Lastwagen und versuchte, ruhig zu erscheinen:
«Gut. Noch etwas mehr Arbeit. Geht es mit meinem Kran?»
«Ja, es sollte gehen. Wo wendest du?»
Tatsächlich, wie wendet man in der Dunkelheit auf einer beidseitig abfallenden Strasse, die nicht breiter als sechs Meter ist? Nur schon nach dem Abhängen und Sichern des Anhängers waren wir bis auf die Knochen durchnässt. Es galt, schnell zu arbeiten. Und trotzdem brauchten wir drei Stunden, um den Volvo zu wenden, den Hino von seiner seitwärts abgerutschten Ladung zu befreien, sie wieder aufzuladen und festzumachen, den Volvo umzukehren, ihn an den Anhänger anzuschliessen und wieder anzurollen. All diese Zeit über arbeiteten wir fast ohne Worte. Doch wie immer, wenn alles vorüber ist, klatschten wir unsere Hände in der Luft zusammen. Um ein Uhr morgens hatten wir einen Ort gefunden, wo wir die Nacht verbringen konnten. Als ich in unserer blauen Kiste aus der Dusche trat, schlief Walter bereits auf dem unteren Kajütenbett, ohne vorher etwas gegessen zu haben. «Das ist ein Zeichen, das ernst genommen werden muss», murmelte ich zu mir selber, während ich langsam etwas Brot und Käse ass. Wir beide hatten manchmal genug von unserer Art zu leben, so oft überarbeitet, so oft nicht richtig essend, so oft an der Grenze, so oft scheinbar sogar unsere Freundschaft in Gefahr bringend. «Wo bringt uns das hin, Herr?», fragte ich in die Dunkelheit. Die Antwort kam genau in dem Moment, da mein Kopf das Kissen berührte, inmitten eines mächtigen Donners, der die blaue Kiste auf dem Anhänger rüttelte: «200'000 Menschen helfen...»
Um halb sechs Uhr morgens sah das Ganze et-was besser aus: Der Regen fiel nur noch leicht, wir hatten etwas geschlafen, und Walter hatte Hunger. Um sechs Uhr sassen wir in den Lastwagen, bereit, die schlimmste Hälfte der Reise anzutreten. Ein «Buen viaje, maestro» und ein «Que Dios nos ayude» wurden über Funk aus-getauscht, und los ging's. Wir benötigten 10 Stunden, um eine Distanz von 70 Kilometern zu bewältigen, das meiste im ersten Gang. Ja, man hätte dabei die Geduld verlieren können, doch das hätte die Sache kein bisschen besser gemacht und Portoviejo kein bisschen näher gebracht. Doch als die Hälfte meiner eigenen La-dung runterkrachte, wurde es ernst. Wir luden die Ladung wieder auf, und Walter schweisste alles zu einem einzigen Block zusammen, und dann den Block auf die Ladefläche des Lastwagens. Der Rest war nur noch Fahren und Aufpassen, nicht von der zerstörten Strasse zu fallen oder im Schlamm steckenzubleiben. Zumindest bewiesen unsere Lastwagenzüge, falls sie diese Fahrt überlebten, dass wir wohl vorbereitet waren für irgendeine andere existierende Strasse Lateinamerikas. Als wir uns gegen Abend endlich Portoviejo näherten, bestaunten die Menschen ungläubig diese Lastwagen, die es geschafft hatten durchzukommen — und als sie begriffen, was diese in die Stadt brachten, winkten sie uns zu und begrüssten uns lautstark. Andere, von ihren schlammbedeckten Vorhöfen aus, riefen uns diese Worte zu, die ich nie mehr vergessen werde: «Tony, danos agua!»
Wir benötigten sieben Tage, um die 55 Meter lange Brücke zu bauen. Für einen Moment stand ich da und sagte mir, welch eine Ehre es eigentlich war, solch eine Brücke bauen zu dürfen. Und ich dachte an die Brücke, und wie sie ihre Melodie summen wird. Pro Tag werden für all diese Menschen 27'000 Kubikmeter Wasser über sie fliessen, was über eine Million Liter pro Stunde bedeutet, oder 300 Liter in jeder einzelnen Sekunde. Sie war unsere Brücke Nr. 93, und vielleicht die wichtigste von allen. Da stand sie nun, in ihrer einfachen Schönheit.
Dann machten wir uns auf in Richtung «nach Hause», denn, wie immer, würden wir nicht bis zur Einweihung warten. Der Beton der letzten Linienverankerung musste immer noch zwei Tage trocknen. Bis dann, mit etwas Glück, würde Walter bereits zu Hause bei seiner Frau in Santo Domingo sein, und ich irgendwo in Quito. Und so kam es, dass zwei Tage später in Quito um Mitternacht mein Mobiltelefon klingelte:
«Tony, habla Rafael. Wir haben vor sechs Stunden zu pumpen begonnen! Keine undichten Stellen. Wir haben das Wasser zurück in Portoviejo, und die Brücke funktioniert. Gracias a ti y a Walter, im Namen der Menschen hier.»
«Gracias a Dios», antwortete ich und lächelte in die Dunkelheit.
Honduras 1999
Der Hurricane Mitch hatte innerhalb weniger Tage gnadenlos das gesamte Land zerstört. 5'600 Tote, 8'000 Verschollene, 12'200 Verletzte, 1'500'000 Betroffene — das war die traurige Bilanz. Es war die schlimmste Tragödie in der Geschichte dieses kleinen Landes in Zentral-amerika.
Nach einer spektakulären simultanen Transportaktion von 150 Tonnen Material aus Houston durch Chiquita Banana und unserer zwei Lastwagen und Wohnkisten aus Ecuador durch die ecuadorianische Luftwaffe sowie eine Schiffslinie, gelangten Walter und ich knappe zwei Wochen nach der Katastrophe ins Land. Die riesigen Mengen an Röhren und Kabel, die uns für dreissig Brücken reichen würden, hatte ich glücklicherweise bereits für den Fall einer möglichen Katastrophe in Zentralamerika über die letzten drei Jahre hinweg in Texas gesammelt. Die schrecklichen Bilder liessen uns nicht zögern, alles nach Honduras zu verschieben. Es war ein überstürzter Abschied aus Ecuador und Südamerika nach Zentralmerika, und ein weiterer riesiger Schritt für uns. Nach fünf Jahren Brückenbauen nur in Amazonien von Ecuador, gefolgt von fünf Jahren kreuz und quer in ganz Ecuador, danach unsere jeweils monatelangen Einsätze in Katastrophengebieten von Kolumbien, Costa Rica und Chiapas, war dies nun ein weiterer Schritt ins Unbekannte. Meine innere Stimme hatte uns einmal mehr den Weg gezeigt, und wir sind gegangen.
Der internationale Flughafen Toncontin in Tegucigalpa hat eine einzige Piste. Sie wird sowohl als ziviler Flughafen und als Luftwaffenbasis genutzt. Die Luftwaffe von Honduras stellte uns zur sicheren Lagerung und Vorfabrikation unserer Brückenkomponenten die gesamte frühere Helikopterpiste zur Verfügung. Während des ganzen Jahres 1999 mögen Flugpassagiere einen Blick von zwei blauen Kisten auf einem An-hänger, von Kleidern, die im Wind trockneten, von Kabelrollen und Haufen von Stahlröhren, von zwei Lastwagen mit Kränen und dem blendenden Licht und von Walter, der am Schweissen der Brücken war erhascht haben. Ich musste nur das Helikopterfeld überqueren, um zum Gebäude des Basiskommandos mit seinem kleinen VIP-Saal zu gelangen. Viele Staatspräsidenten, Minister, Botschafter und Militäroffiziere, unterwegs auf wichtigen Missionen, haben in diesem Raum gesessen. Unter Zeitdruck scheinen nicht viele von ihnen sich Zeit genommen zu haben, in diesem VIP-Saal ein blaues Buch zu bemerken, das mit goldenen Buchstaben verziert ist: das Gästebuch. Aber am 8. Juli 1988 hatte eine bescheidene Dame mit ihrer zierlichen und klaren Handschrift einen Satz geschrieben, der ihr ganzes Leben und ihre Botschaft zusammen-fasst: «Liebt einander so wie Gott jeden einzelnen von euch liebt. Mutter Teresa MC, Indien.»
In diesem VIP-Saal verbrachte ich 1999 mit Schreiben und Abholen von Nachrichten über Internet, mit Organisieren, mit Bitten um Gefallen und Danken für Gefallen unzählige Nächte. Jedes Mal, wenn ich durch diese Tür eintrat, musste ich daran denken, dass vor wenigen Jahren Mutter Teresa gestanden und ihre Worte niedergeschrieben hatte. Diese Worte, die in unserem alltäglichen Leben so schwer anwendbar sind. Und dennoch, es war nicht bloss ihr Satz aus dem Gästebuch, sondern ein weiterer Satz von ihr, der in meinem Kopfe kreiste: «Das Wunder ist nicht, dass wir diese Arbeit tun, sondern dass wir sie mit Freude tun.»
Das Wunder ist nicht, dass wir im Jahre 1999 30 Brücken für über 150'000 Menschen bauen konnten, sondern, dass wir es noch immer mit Freude tun. Denn manchmal scheint es einfach zu viel zu sein: Doch Mitleid und Hoffnung sind machtvolle Heilmittel, und ihre Sprache ist deutlich. So wie diese Bilder in Honduras: das Bild jenes alten Mannes in Guayape, Olancho, der seinen verrunzelten Körper zu gehen zwang. Ein Körper, so gewaltig geschüttelt von einer schweren Parkinson-Krankheit, und dennoch, auch er trug seinen Steinbrocken für die neue Brücke zu seinem Dorf. Oder das Bild der armen Frau mittleren Alters in Santa Cruz, barfuss und in zerfetzten Kleidern, langsam, aber unaufhaltsam hin- und herschlurfend mit einem Steinbrocken nach dem anderen, die sie alle so vorsichtig niederlegte, als ob sie ein Neugeborenes in die Wiege bettete. In einer anderen Zeit musste sie sehr schön gewesen sein und voll Energie. Doch jetzt war sie stumm wie ein Grab, ihr Blick verloren in einem unbekannten Raum wo niemand sie zu erreichen schien. Oder das Bild bei der grossen 170-Meter-Brücke in El Negrito, Yoro, mit all den Männern, die in ihrer einem Tausendfüssler ähnlichen Schlange aus voller Lunge brüllen, um sich Mut zu machen, um die 220 Meter langen Hauptträgerkabel über den Fluss zu tragen. Und jener junge Mann in seinem lottrigen Rollstuhl bei der Conchagua-Paraiso-Brücke sehnsüchtig die Fertigstellung der Brücke betrachtend, die Augen voller Tränen. Und schliesslich die Bilder der Kinder: inmitten ihres Spielens und Gelächters tragen sie immer irgendwie bei zum Bau einer Brücke, welche dann sogar ihren eigenen Kindern eines Tages noch nützen mag. Es gibt so viele Taten der Hoffnung, die sich in so vielen persönlichen Geschichten abspielen. Sie mögen zwar wenig wichtig erscheinen, doch hier kommen sie alle zusammen für ein gemeinsames Ziel: ihre eigene Brücke zu bauen.
Genau rechtzeitig zu Weihnachten hatten wir unsere 29. Brücke in Honduras fertiggestellt, mit den letzten Resten an Material. Für die Menschen in San Miguel de Ocotepeque, hinter den Bergen im Westen von Honduras, nur wenige Kilometer von der Grenze zu El Salvador und Guatemala, brachte die Weihnacht ihr grösstes Geschenk hoch über dem Rio Lempa: eine wunderschöne 80-Meter-Brücke. Die Bewohner nennen sie «El Puente del Milagro», die Brücke des Wunders. Weil wir aus dem Nichts aufgetaucht seien und sie jetzt ihre selber gebaute Brücke hier stehen sehen. Für sie bedeutet diese Brücke, dass sie endlich den Fluss überqueren können, bei Tag und bei Nacht, bei Regen und Donner, bei Hochwasser und Windstürmen, Frauen und Kinder alleine, so oft sie wünschen. Für uns hingegen bedeutet diese 130. Brücke: weiterziehen in ein anderes Land, zu anderen Flüssen, zu anderen Menschen in Not.