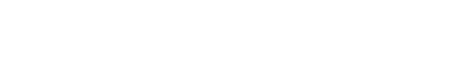1996 Heinrich Schmid

Geboren am 6. April 1921 in Zürich. Studium der Romanistik an der Universität Zürich, Aufenthalte in Florenz, Paris, Rom und in Rumänien. 1963-1983 Professor für romanische Sprach-wissenschaft an der Universität Zürich. Sprach-geschichtliche und sprachgeographische Arbei-ten. 1982 verfasste Heinrich Schmid die Richt-linien für das Rumantsch Grischun, der seither u. a. auf Bundesebene gebrauchten Form der vierten schweizerischen Landessprache. Heinrich Schmid verstarb am 23. Februar 1999.
In Würdigung seiner klugen und verständnisvollen Schöpfung der Grundlagen des Rumantsch Grischun, der gemeinsamen Schriftsprache der Bündner Romanen.
Laudatio
Beat Sitter-Liver
In Chur sind wir zusammengetroffen, meine Damen und Herren, um einen Zürcher zu feiern, und dies im Zusammenhang mit dem Rumantsch Grischun, der schriftlichen Koiné der Bündnerromanen. Die örtliche Trennung zwischen Ihrem Lebensaufenthalt, verehrter, lieber Herr Professor Schmid, und dem Bündner Hauptort gibt zu denken. Sie lässt uns vermuten, dass wir, gäbe es nicht den Zürcher aus dem Unter- und, in gewissem Sinne, aus dem Ausland, kaum Anlass hätten, uns heute über die Blüte einer bündner-romanischen Gemeinsprache zu freuen. Denn eben das tun wir, wenn wir Sie mit dieser Feier auszeichnen, unter anderem um Ihnen zu danken, jede und jeder aus besonderem Grund. Hoffen wir, die Bündnerromanen mögen Ihnen noch in später Zeit einmal schulden, dass sie sich ihre schönen und reichen Sprachen erhalten konnten. Ob das auch bedeuten mag, worauf Sie selber in einer Anmerkung zu den «Richtlinien für die Gestaltung einer gesamt-bündnerromanischen Schriftsprache» hinweisen? Sie zitieren da den Geschichtsschreiber Gilg Tschudi aus dem 16. Jahrhundert: «Die Rhetijsch spraach ist nit gericht, das man die schryben koenne, dann all brieff und geschrifften in jrm Lande, sind von alter har in Latin, und yetz mehrheits zu tütsch gestellt. Es ist ouch nit wunder, das die sitten und spraach by jnen ergrobet» (Annalas 1989, S. 5 f.). Führt die nun doch entstandene schriftliche Koiné mit der sprachlichen Verbesserung zur Verfeinerung der Sitten? Abwegig ist der Gedanke nicht. Angesichts der weltweit ausgreifenden zivilisatorischen Einebnung und kulturellen Verflachung bildet jede eigenständige kulturelle Erneuerung ein Lebenszeichen von unschätzbarem Wert. Was die Brandenberger-Stiftung angeht, so möchte sie, lieber Herr Schmid, Ihre besonderen Verdienste auf dem - weit ausgesteckten - Felde der Kommunikation ins öffentliche Licht rücken. Zwei unterschiedliche, freilich nur gemeinsam erbrachte Leistungen hat die Stiftung vor Augen: Einmal errichteten Sie den Romanen Graubündens eine Plattform, die diese ausprüfen, auf der sie sich frei bewegen mögen, um sich in neuer und doch zugleich altvertrauter sprachlicher Weise zu begegnen. Sie haben die Plattform nicht als zwingenden Aufenthalt gestaltet, sondern als Angebot, das erst durch die eigenständige Bemühung jener, die es ergreifen, ausreift. So lädt diese Plattform zu gleichsam spielerischer Tätigkeit ein, aus der eine frische Lebensform entstehen kann, die noch unbekannte Bindungen knüpft. — Zum andern vermochte Ihr Werk allein deshalb zu gelingen, weil Sie es mit der erforderlichen Umsicht, mit grosser Achtung den vielen gegenüber, ohne deren Zutun der Erfolg ausgeblieben wäre, an die Hand nahmen. Mit viel Geschick dazu, wohl auch mit Witz und et-was List. Unternehmerinnen und Unternehmer wissen heute, wie sehr das Schicksal ihrer Firmen von guter Kommunikation abhängt. Die nötigen Eigenschaften, so will es verbreitete Über-zeugung, vermittelt besonders gut ein Studium im Bereiche der Geistes- und Sozialwissenschaften. Bedürfte es eines Beweises, wir hätten einen lebenden zur Hand: Heinrich Schmid, den grossen Kommunikator, der selbst in von vielen Tälern zerteiltem, oft rauhem und unwegigem Gebiet widerstrebende Kräfte und Interessen, unterschiedliche Alter und Geschlechter in einem erfolgreichen Projekt zu vereinen wusste. Heinrich Schmid feierte im April dieses Jahres im «heimatlichen Zürich» seinen 75. Geburtstag (6.4.1921).1 In einer Familie mit praktischem wie theoretischem Sinn für Sprachen aufgezogen, fesselte ihn die «mysteriöse(n) Welt des nur Schwer- oder gar völlig Unberechenbaren», die «in Raum und Zeit variable(n) Erscheinungswelt der Sprache» schon in den ersten Schuljahren. Das imposante Formensystem des Lateins zog ihn in Bann, dem Französischen schenkte er sein Herz, das Griechische bereitete ihm ein Vergnügen besonderer Art. Bald aber genügte das in der Schule Gebotene nicht; auf eigene Faust begann er neben dem Italienischen Spanisch und Rätoromanisch zu lernen und stiess «in die neuen, ungemein fesselnden Bereiche der Sprachvergleichung und Sprachgeschichte» vor (Schmid 1991, 213 f.). Im Herbst 1940 nahm er das Studium der Romanistik an der Zürcher Almamater auf. Seine Absicht, französische Sprache und Literatur als Hauptfach zu wählen, wurde nicht zuletzt durch die schlimmen politischen und katastrophalen humanen Verhältnisse im damaligen nördlichen Nachbarland bestimmt. Von faszinierenden Lehrern wie Jakob Jud, Arnold Steiger und Manu Leumann geprägt und gefördert, wandte er sich neben Sprachgeschichte und -geographie der Hispanistik, der Indogermanistik und schliesslich der Slavistik zu. Schon im Frühjahr 1946 schloss er seine akademische Erstausbildung mit den Fächern «Vergleichende Geschichte der romanischen Sprachen», «Italienische Sprache», hier mit dem Schwerpunkt Dialektologie, sowie Slavistik ab. Es folgten die Assistenz am Romanischen Seminar der Universität Zürich, Aufenthalte in Florenz, Paris, Rom und in Rumänien. Wiederum Autodidakt, machte sich Heinrich Schmid mit dem Rumänischen vertraut, um «Zugang zum ebenso attraktiven wie instruktiven Gebiet der Balkanlinguistik» zu gewinnen (Schmid 1991, 217). In materieller Hinsicht, so schreibt er einmal, ging's zunächst mager zu und her. Davon, dass er sich wegen eines geschwächten Gehörs den Gymnasiallehrerberuf versagen musste, profitierte Romanischbünden: von Hans Schorta, seinem Chef, Förderer und Freund gerufen, arbeitete er am «Rätischen Namenbuch» und dann insbesondere am «Dicziunari Rumantsch Grischun» mit. 1962 erfolgte die Habilitation, schon im Herbst des Folgejahres die Ernennung zum Assistenzprofessor, drei Jahre später die Beförderung zum Extraordinarius. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1983 ist Heinrich Schmid seinem akademischen Zürcher Stammhaus treu geblieben. Erst als er es verliess, fand er Raum für einen neuen formellen Treueschwur und heiratete die Gefährtin vieler Jahre, Veronica Bruppacher. Unverwandt war er freilich auch nach dem Eintritt in den Lehrkörper der Universität dem bündnerromanischen Wörterbuch verbunden geblieben, zu dem er als Redaktor an die 140 Artikel im Umfang von über 300 Spalten beige-tragen hatte: als Mitglied der Philologischen Kommission, während 15 Jahren (1969-1984) als deren Präsident (Hilty 1985, 3).
Im Jahre 1986 - Sie zählten, lieber Herr Schmid, Ihr 65. Wiegenfest — würdigte Professor Gerold Hilty, Ihr Zürcher Kollege und langjähriger Freund, Ihre wissenschaftlichen Verdienste in der Vox Romanica. Mit aller nur wünschbaren Klarheit lässt seine Widmung jene Züge Ihrer Person und Ihrer Arbeit hervorspringen, die Sie für den Entwurf der Grundlinien des Rumantsch Grischun und für deren erste Verbreitung prädestinieren sollten. Als Grenzgänger zeichnet sie Gerold Hilty, ein Grenzgänger freilich, der, was er begeht, zu überwinden trachtet, um Getrenntes zu verbinden und dadurch Unerwartetes, Neues zu gewinnen. Sprachgrenzen, so lesen wir, haben Sie in doppelter Hinsicht immer fasziniert: «Als Herausforderung, sie zu überschreiten, und dann als Kontaktzonen, in denen neben Trennendem auch Verbindendes vorhanden ist» (Hilty 1985, 1). Das methodische Prinzip, dem Sie sich bei der Ausarbeitung der Richtlinien für das Rumantsch Grischun verschrieben, ist damit auf den Begriff gebracht. Nur dass es für Sie wohl nicht ein Grundsatz war, den Sie sich, bloss klug abwägend, wählten, sondern eine Lebenshaltung, eine Tugend, die sich überall in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ausprägt. Gerold Hilty gibt eindrückliche Beispiele, deren Zitierung ich mir aus Zeitgründen versagen muss. Eines allerdings darf ich Ihren und unseren Gästen nicht vorenthalten, weil es besonders deutlich spricht: Die Grenzen der romanischen Sprachen hatten Sie bereits mit der Indogermanistik und mit der Slavistik hinter sich gelassen. Doch auch im germanischen und im keltischen Bereich machten Sie sich kund, so dass Sie Ihre Habilitationsschrift zwischensprachlichen Kontakten und sekundären Gruppierungen unter den europäischen Sprachen schlechthin widmen konnten. «Unter dem Titel ,Europäische Sprachräume'» betrachteten Sie nicht weniger als 36 verschiedene Sprachen. Sie zeigten unter anderem, dass die traditionelle Einleitung «in eine romanische, germanische, keltische, baltische, slavische und ugro-finnische Gruppe (nebst kleineren Sprachräumen) im Laufe der Geschichte überlagert worden ist durch eine neue Gruppierung, die mehr auf gemeinsamen geschichtlichen Schicksalen als auf gemeinsamem Ursprung beruht» (Hilty 1985). Auch für den Nichtphilologen springt aus dieser Skizze hervor, mit welcher grossen Umsicht Sie Ihre Untersuchungen führten, sorgfältig darauf bedacht, präzise Detailkenntnisse aus verschiedensten Bereichen zu verbinden, um dem Gegenstand Ihrer Arbeit möglichst gerecht zu werden.
Konkrete Begegnung und Kommunikation also auch hier, viel mehr als Konstruktion und spekulative linguistische Theorie, der gegenüber Sie «ein radikales Misstrauen» nie zu überwinden vermochten. Ich habe selber geschmunzelt, als ich las, wie Sie den Realitätswert gewisser theoretischer Ansätze bewerteten, indem Sie Roman Jakobson zitierten; er soll gesagt haben, «Tiefenstruktur, das gibt es nicht in der Sprache, das gibt es nur in den Köpfen der Linguisten» (Schmid 1991, 217).
Begegnung, Ernstnehmen des Gegenübers, Brücken bauen gerade dort, wo Verständigung nicht ohne weiteres gelingt, war Ihnen ständiges Anliegen. Auch im akademischen Unterricht. Eine Ihrer Schülerinnen und Mitarbeiterinnen, Frau Dr. Anna-Alice Dazzi Gross, erinnert sich gut daran, wie Sie Ihr Sprach- und Kommunikationsverständnis in der Praxis vorlebten, im privaten Umgang nicht minder als in der Lehrtätigkeit und später im Engagement für die gesamt-bündnerromanische Schriftsprache (eine unelegante Wortschöpfung, die wir Ihnen verdanken (1991 S. 217), welche aber akurat die Not spiegelt, die Sie zuweilen empfunden haben müssen im Bestreben, keinen und keine der Bündner-romanen aus dem sprachschöpferischen Prozess auszuschliessen, den Sie angestossen hatten). Sprachwandel und Sprachvariation, so formuliert Frau Dr. Dazzi Gross, sind die Schlüsselbegriffe Ihres Sprachverständnisses. Sprache lebt als historischen Entwicklungen unterworfenes Kommunikationsmittel; sie weist räumlich differenzierte Formen, Varietäten auf; sie ist gesellschaftlich, also auch schichtspezifisch geformtes Instrument, Ausdruck- und eben Austauschmittel für Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, Empfindungen, kurz: für Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen, die sie fixiert, tradiert und dem Wandel offenhält. Sie veranschaulicht in einzigartiger Weise menschliches Dasein, das sich durch ständige Bewegung und Veränderung charakterisiert.2 Es ist Ihnen gelungen, Ihre Faszination im Erleben des Wirkens der Sprache unter Menschen, angesichts der Möglichkeit der Verständigung über Abgründe hinweg, die sie birgt, auf Ihre Studentinnen und Studenten zu übertragen. In Ihren Vorlesungen suchten Sie den Dialog, sie gestalteten diese als Kolloquien, vermittelten zwar sachliche Information, förderten jedoch zugleich die Kultur des wissenschaftlichen Diskurses. Waren Seminararbeiten zu besprechen, wählten Sie den privaten Raum. Ohne in der wissenschaftlichen Strenge nachzugeben, liessen Sie Ihr Gegenüber spüren, dass Sie es achteten, auch in seinen studentischen Nöten und Ängsten. Noch in der Kritik suchten Sie nach verdeckten Fähigkeiten und Qualitäten des Gegenübers. So bereiteten Sie den Boden für ein wirklich kreatives, weiterführendes Gespräch. Sie mögen sich fragen, meine Damen und Herren, warum ich Ihnen dieses Zeugnis vorlege. Die Antwort findet sich schnell: Es lüftet den Schleier über dem Geheimnis des Erfolgs, den Heinrich Schmid mit seiner Grundlegung des Rumantsch Grischun einbrachte. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Lassen Sie uns den Preisträger selber berichten, nicht jedoch ohne vorauszuschicken, was seine Bescheidenheit ihn zu unterschlagen veranlassen würde: Richtlinien für ein Rumantsch Grischun wären nicht so rasch und trefflich entstanden, wäre da nicht ein überaus kompetenter Kultur- und Sprachwissenschafter am Werk gewesen, der sich mit sämtlichen bündnerromanischen Idiomen vertraut gemacht hatte. Doch das allein hätte nicht genügt. Erfordert war zudem eine tiefe Liebe zu Land und Leuten, zu ihrer Sprache und ihrer Literatur. Diese Liebe brannte im Herzen von Heinrich Schmid.
Zur Vorgeschichte' gehören die seit 1870 wiederholt gescheiterten Bemühungen, sich in Romanischbünden auf eine Gemeinsprache zu einigen. Traditionalistische, konservative und, um einen Ausdruck Heinrich Schmids zu gebrauchen, extrem partikularistische Reaktionen auf fürs Romanische entflammte Bürgerinitiativen aus der übrigen Schweiz liessen Scherbenhaufen entstehen, wo konföderale Hilfsangebote dem Romanischen Überlebensbrücken zu errichten versprachen. Der Schock der 1980er Volkszählung, die belegte, wie rasch der Verdeutschungsprozess die Romania dezimierte, löste einen Gesinnungswandel aus und hob für den Sekretär der Lia Rumantscha, Dr. Bernard Cathomas, der längst von der Überlebensnotwendigkeit einer schriftlichen Koin6 überzeugt war, die Barriere, welche den Weg zu therapeutischen Massnahmen versperrte. Im Bündnerland fand er keinen Lotsen, das Schiff-lein einer schöpferischen Sprachtat durch die Wogen lokaler und regionaler Interessen und Empfindlichkeiten zu steuern. So fuhr er, kurz nachdem das Jahr 1982 angebrochen war, nach Zürich, um Heinrich Schmid dafür zu gewinnen, ein Konzept für den Aufbau einer überregionalen Schriftsprache auszuarbeiten. Dieser musste dem Argument weichen, wonach im Bündnerland sich kein Romane finde — an Linguisten, die der Aufgabe gewachsen waren, fehlte es keineswegs — kein Romane, der nicht durch seine Verbundenheit mit einer Regionalsprache vorbelastet und dem Misstrauen seiner Landsleute ausgesetzt wäre. Er tat es rasch, überzeugt davon, dass es künftig «ein Romanisch oder kein Romanisch» (Richtlinien, S. 5) gebe, dass andererseits die Erhaltung der kulturellen und darin der sprachlichen Vielfalt Gebot der Stunde sei. Knapp vier Monate später, im April 1982, lag ein erster Entwurf vor. Und nun kam das einzigartige kommunikative Geschick Heinrich Schmids zum Zuge. Nicht nur gelangte der im April vorgelegte Entwurf in eine breite Vernehmlassung bei Romanen aller Teilgebiete. In vielen Gesprächen hatte Heinrich Schmid seine Arbeiten und Vorschläge den zünftigen Romanisten in Bünden unterbreitet und mit diesen diskutiert, von sich aus Varianten erwogen, Fragen gestellt, auf die er im stillen Kämmerlein die Antworten längst gefunden haben mochte. Man begegnete ihm mit grossem Vertrauen und schenkte ihm Glauben, denn ganz offensichtlich erbrachte er seine Arbeit aus Begeisterung und mit bester Kraft, uneigennützig, allein der Sache verpflichtet. Der April-Entwurf fand breite Zustimmung, wurde in wenigen überarbeitet und schon im Juni 1982 veröffentlicht, jetzt eben unter dem Titel «Richtlinien für die Gestaltung einer gesamt-bündnerromanischen Schriftsprache Rumantsch Grischun». Von den zahlreichen Überlegungen, die Heinrich Schmids Arbeit getragen hatten, will ich wiederum nur zwei aufgreifen. Einmal die Methode der Vermittlung, in kluger Selbstbeschränkung gewählt, entgegen der eigenen Überzeugung, die einfachste und sympathischste Lösung «hätte darin bestanden, einem der bestehenden Schriftidiome die Rolle einer Überdachungssprache» zuzuweisen (Schmid 1989, S. 14). Ausgangspunkte bildeten Vallader und das Surselvische als die beiden zahlenmässig stärksten Idiome. Wo sie differierten, diente Surmiran als Schiedsrichter (ebd., S. 16). Sodann nahm sich der Wissenschafter vor, eine Schrift- und Lesesprache zu schaffen, die jeder gutwillige Bündnerromane problemlos versteht, ohne sie eigens gelernt zu haben. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Ziel, wiederum der Achtung und der Rücksichtnahme den Betroffenen gegenüber verpflichtet, erreicht wurde.
Noch immer ist nicht alles Entscheidende aufs Tapet gebracht, meine Damen und Herren. Was wir aus unserem eigenen Alltag kennen, aus dem Umgang mit bald flüggen Kindern ganz besonders, spielt auch bei der Entstehung des Rumantsch Grischun eine wichtige Rolle: Kommunikation verwirklicht sich optimal nur für diejenigen, die sich zurückzunehmen vermögen, die loslassen können, was ihnen ans Herz gewachsen ist, um es auf eigenen Wegen ausreifen zu lassen. Eben dazu hat Heinrich Schmid sich verstanden. Er wusste und betonte, dass die philologische, die linguistische Arbeit an einer klaren und tragfähigen Basis für das Rumantsch Grischun nur die eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Standardisierung bereitstellte. Der zweite, nicht weniger wichtige Schritt läge in der Übersetzung der Grundlagen in die Sprachpraxis. Hierzu wurden grosse Anstrengungen erfordert, die andere zu erbringen hatten und noch haben, so «Il Post da Rumantsch Grischun», bei der Lia Rumantscha eingerichtet; Bemühungen in die sich der Schöpfer der Grundlagen mit Vorteil nicht einmischte. Heinrich Schmid respektierte wie selbstverständlich diese Regel. Er liess sein Kind laufen, stand nur zur Verfügung, wenn es von sich aus seinen Rat begehrte. In der Tat ein weiser Vater! Ein Vater allein bringt kein Kind zur Welt. An Dank für die gewichtige Unterstützung, die ihm von mancher Seite, in erster Linie seitens der Lia Rumantscha zuteil geworden war, hat Heinrich Schmid es denn auch nie fehlen lassen. Er hat ihn wiederholt öffentlich abgestattet und publiziert, im Wissen darum, dass das Rumantsch Grischun nur als Gemeinschaftswerk zustande gekommen ist und weiterlebt. Die Vaterschaft hatte er auch nicht aus freien Stücken gesucht, er war zu ihr erkoren worden. Dem weitsichtigen und selber sehr engagierten Sekretär der Lia Rumantscha, Dr. Bernard Cathomas, der zu ihm nach Zürich gepilgert war, um ihn für die grosse Herausforderung zu gewinnen, hat er ein eigenes Kränzchen gewunden (Schmid, 1989, S. 15 u.ö.). Auch ich möchte eine Rose da hineinstecken und mich für die wertvollen Auskünfte bedanken, mit denen mir Bernard Cathomas, in grosser Geduld, die Abfassung meiner Laudatio erleichtert, ja zum Vergnügen gemacht hat.
Ihnen, lieber Heinrich Schmid, ist diese ja zugedacht. In Ihrem autobiographischen Bericht von 1991 unterrichten Sie uns davon, dass Ihr Wirken in Romanischbünden einen analogen Ruf aus Ladinisch-Südtirol nach sich gezogen hat. Auch dort haben Sie Ihre Arbeiten nun abgeschlossen und können beobachten, ob sich Ihre Hoffnung erfüllt, «ebenfalls zur Überwindung innerer Gegensätze, und damit zur Stärkung einer weiteren vom Untergang bedrohten Minderheit» beigetragen zu haben (Schmid 1991, S. 218).
Zum Schluss Ihres Berichtes lassen Sie uns wissen, dass die «zum Teil fast mehr diplomatischen als sprachwissenschaftlichen Aktivitäten... den Wunsch nach erneuter Betätigung im Bereich der ,zweckfreien' Forschung nicht zu verdrängen» vermochten. Neue Themen locken, «alte, nie verwirklichte Pläne». Trotz des übersättigten Marktes wissenschaftlicher Schriften sind Sie versucht, «noch das eine und andere zu publizieren» (Schmid 1991, S. 218). Nur zu gerne stehen wir Ihnen mit unseren besten Wünschen bei, wenn Sie sich die dazu nötige «Narrenfreiheit» herausnehmen: In Ihren Unternehmungen viel Kraft, gutes Gelingen und etliches Vergnügen, dass erhoffen wir für Sie von Herzen. Mag Frau Veronica mit Ihnen zusammen noch viele glückliche Jahre geniessen!
Wie alles Lebendige, verändert sich auch jede Sprache
Heinrich Schmid
Vor allem andern habe ich hier zu danken: in erster Linie den Organen der Stiftung Dr. J. E. Brandenberger, das heisst der Preiskommission sowie dem Stiftungsrat und seinem Präsidenten, Herrn Dr. Karel Zoller. Mit der Wahl zum Preisträger dieses Jahres haben sie mir eine der grössten und erfreulichsten Überraschungen meines Lebens bereitet. Danken möchte ich auch Herrn a. Bundesrat Dr. Leon Schlumpf, der die Freundlichkeit hatte, sich um die Organisation und den musikalischen Rahmen des heutigen Anlasses zu kümmern. Herr Bundesrat Schlumpf war übrigens, soviel ich weiss, der erste, der sich in öffentlicher Rede der neuen bündnerromanischen Standardsprache bediente. Es war an einer Tagung in Solothurn, im April 1983. Zu einer Zeit also, als andere noch einen grossen Bogen um den heissen Brei machten, hat sich der damalige Landesvater aus Graubünden nicht gescheut, das gefährliche Objekt geradewegs — wenn ich so sagen darf — in den bundesrätlichen Mund zu nehmen und einen Teil seiner Ansprache auf Rumantsch Grischun zu halten. Ich glaubte meinen Ohren kaum trauen zu dürfen und werde die Überraschung jenes Augenblicks nie vergessen. Es war wie ein gutes Omen für die Zukunft der noch auf schwachen Füssen stehenden sprachlichen Neuerung.
Ein besonderer Dank gilt auch meinen Vorrednern. Nach den Worten der Anerkennung und des Lobes, die ich eben zu hören bekam, wäre ich nun eigentlich versucht, im Interesse einer realistischeren Sicht der Dinge etwas Gegen-steuer zu geben und darüber zu berichten, was ich so im Laufe von 75 Lebensjahren alles falsch gemacht habe. Allein, das wäre eine lange Geschichte, und ein Sündenbekenntnis ist wohl nicht genau das, was Sie hier und jetzt von mir erwarten.
Hingegen ist es ein Gebot der Fairness und der Gerechtigkeit, meine Arbeit in einen grösseren Rahmen hineinzustellen. Ich werde hier als Einzelner ausgezeichnet für ein Unternehmen, bei dem ich zwar den ersten Schritt getan habe, an dem aber auch andere mitwirkten, das andere weiterführten (und weiterführen) und das ohne den Einsatz einer vorbildlich arbeitenden Organisation, der Lia Rumantscha, nie wirklich in die Praxis umgesetzt worden wäre. Ein grosser Teil meiner Mitarbeiter der ersten Stunde ist hier anwesend, und ihnen fühle ich mich heute besonders verbunden. Den Anfang machte Dr. Bernard Cathomas, Sekretär der Lia Rumantscha, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der die Arbeiten mit stets wacher Anteilnahme begleitete und das Schifflein mit sicherer Hand durch die nicht immer ruhigen Gewässer steuerte. Weiter sind mir in bester Erinnerung: Herr Jachen Andry, damals Student an unserer Universität, mein wichtigster Mitarbeiter in der allerersten Phase, ein Romane, bei dem genaue Kenntnis der Muttersprache mit grossem Sachverstand und Fingerspitzengefühl einhergeht; dann die beiden unermüdlichen Ritas: Frau Rita Uffer und Frau Rita Cathomas, welche beide von der ersten Zeit an Übersetzungen und Texte in der neuen Schriftsprache verfassten, ohne dabei Überstunden und unbezahlte Nachtarbeit zu scheuen. Von grösster Bedeutung war im folgenden die Arbeit der Leiter des «Post da rumantschgrischun» bei der Lia Rumantscha, Dr. Georges Darms, nunmehr Professor an der Universität Freiburg im Uechtland, und Frau Anna-Alice Dazzi Gross, die sich ebenfalls grosse Verdienste um die im Entstehen begriffene Standardsprache erworben hat und stets noch erwirbt. Weiter sind in diesem Zusammenhang vor allem zu nennen: Gian Peder Gregori, Dr. Manfred Gross und Gieri Menzli. Nicht vergessen möchte ich hier den verehrten Meister Andrea Schorta, den ich ebenfalls zu meinen Beratern zählen durfte, wie auch die nie versagende Unterstützung durch meine Frau: sie hat nicht nur mitgelitten in Zeiten des Zweifels und der Bedrängnis; sie hat immer wieder auch mitgedacht.
Es ist leider nicht möglich, hier all die guten Geister namentlich zu erwähnen, die im Laufe der Zeit zu der engagierten Schar stiessen, so unter anderem die Gründer (Gründerinnen!) und Mitglieder der Uniun Rumantsch Grischun, aber auch Dichter und Schriftsteller (Frauen und Männer), die sich anschickten, Rumantsch Grischun zu schreiben und damit der armen Amts- und Plakatsprache ein besseres Leben einzuhauchen. Ich bitte die vielen Ungenannten um Verzeihung, wenn ich ihnen hier nur pauschal als namenlosen Freunden und Verbündeten meinen Dank abstatte. Sie alle haben zum Gelingen beigetragen und hätten eigentlich auch einen Preis verdient. Nun aber haben sie lediglich das vielleicht nicht ganz zweifelsfreie Vergnügen, zuzuschauen, wie ein anderer prämiert wird. Ich habe im Sinn, der damit angedeuteten Problematik etwas von ihrem Gewicht zu nehmen, indem ich die mir zugesprochene Preissumme nicht einfach in meiner Tasche verschwinden lasse, sondern zu einem wesentlichen Teil für unser gemeinsames Ziel einsetze: die Förderung und Stärkung des Rätoromanischen, nicht nur des Rumantsch Grischun im engeren Sinne.
Und nun zur Sache selbst: Was ist dieses sogenannte «Rumantsch Grischun»? Warum wurde es geschaffen? Wie ist man dabei vorgegangen und wie bin ich als Nichtromane und Nicht-bündner dazu gekommen, Richtlinien für eine gemeinsame Schriftsprache aller Rätoromanen Graubündens aufzustellen? Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, wissen darüber Bescheid; aber nicht alle, und darum muss ich et-was weiter ausholen und von Dingen sprechen, die Ihnen zum Teil schon bekannt sind.
Nach der Volkszählung von 1980 lebten damals in der Schweiz rund 51'000 Rätoromanen, wo-bei in dieser Zahl auch die noch sprachlosen Säuglinge und Kleinkinder mitenthalten sind. Für eine ganze Sprachgemeinschaft ist das kein überwältigender Befund, auch wenn wir der Meinung sind, Qualität gehe vor Quantität. Aber mit der Qualität allein ist es leider nicht immer getan. Sie wissen ja, wie es zugeht in der bösen Welt, in der wir leben: der Grosse frisst den Kleinen. Nun sprechen die Rätoromanen Graubündens bekanntlich eine beeindruckende Zahl höchst interessanter Mundarten — für jeden Sprachliebhaber eine Quelle des Entzückens! Aber nicht nur das: Die Bündnerromanen hatten bis vor einigen Jahren auch keine gemeinsame Schriftsprache, es sei denn das Schriftdeutsche. Sofern sie romanisch schreiben, brauchen (oder brauchten) sie fünf verschiedene Idiome mit je eigenen Regeln, eigener Grammatik und eigenem Wortschatz — auch das notabene zur naiven Freude aller waschechten Linguisten. Auch ich habe mich über diese Vielfalt stets herzlich gefreut, mir allerdings auf der andern Seite auch gewisse subversive Fragen gestellt. In der Tat: Ist es gut, wenn eine an sich schon kleine Sprachgemeinschaft auch auf der schriftsprachlichen Ebene (nur diese steht hier zur Diskussion!) sich den Luxus einer derartigen Zersplitterung leistet, wo doch eine Sammlung aller Kräfte dringend vonnöten wäre, um dem Vordringen des Deutschen einen Riegel zu schieben? Denn dass das Romanische seit Jahrhunderten zurückweicht, darüber kann man sich nicht täuschen. Einst reichte es bis zum Bodensee und in die Linth-ebene; noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war fast die Hälfte der bündnerischen Bevölkerung romanischer Muttersprache, um 1900 war es noch ein Drittel, um 1980 nurmehr rund ein Fünftel. Und statt vor dem geschlossenen Sprachgebiet von einst stehen wir heute, was das Territorium mit romanischer Mehrheit betrifft, vor einem Archipel, bestehend aus fünf bis sieben Inseln und Inselchen, die in der steigenden deutschen Flut zu ertrinken drohen — aber nicht ertrinken müssen, wenn sich die Rahmenbedingungen entscheidend ändern. Dass unerwartete positive Entwicklungen sehr wohl im Bereich des Möglichen liegen, zeigt unter anderem die Sprachgeschichte des Val Müstair in unserem zwanzigsten Jahrhundert. Um 1900 wurde dem Münstertaler Romanischen von einem deutschen Professor ein stetiger Rückgang, im untern Talabschnitt sogar — alles mit exakter wissenschaftlicher Begründung — der nahe bevorstehende Untergang prophezeiht. In Wirklichkeit nahm im Münstertal zwischen 1900 und 1970 nicht nur die absolute Zahl der Romanen, sondern auch ihr relativer Anteil an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich zu, und zwar von 77,7 Prozent auf 86,4 Prozent, und ist auch heute noch einer der höchsten von allen bündnerischen Talschaften. Auch in Müstair, der untersten Gemeinde, stieg der Anteil auf 86,2 Prozent statt des vermeintlichen totalen Untergangs. Das ist durchaus nicht die einzige negative Prognose, die sich nicht erfüllt hat. Auch einzelne Gemeinden in der Surselva, die noch jetzt mehrheitlich romanisch sind, wären nach damaliger Voraussage bereits um 1920 deutschsprachig geworden — und so weiter. Vor Untergangspropheten sei somit gewarnt, auch wenn sie ex cathedra loquuntur!
Nun ertönte allerdings, bald nachdem die Ergebnisse der Volkszählung von 1980 bekanntgeworden waren — diese hatten ein weiteres Abbröckeln und eine fortschreitende Ausdünnung des rätoromanischen Sprachgebietes erkennen lassen —, ein Alarmruf. «La mort dil romontsch ni l'entschatta della fin per la Svizra» (Der Tod des Romanischen oder der Anfang vom Ende für die Schweiz), so lautete der Titel einer Publikation, die auch in französischer, italienischer und deutscher Sprache erschien. Dem Verfasser, Jean-Jacques Furer, kommt wohl in erster Linie das Verdienst zu, die schweizerische Öffentlichkeit aufgerüttelt zu haben. Es zeigte sich, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung nicht bereit war, sich mit dem Dahinschwinden der vierten Landessprache einfach abzufinden. Solidarität mit den Rätoromanen meldete sich aus allen Landesteilen, damit aber auch die Bereitschaft, das Romanische in der Praxis, im amtlichen Verkehr, in der Werbung usw. mitzuberücksichtigen. Aber eben: Welches der fünf Idiome sollte man denn schreiben? Mehr als eine Variante kam in der Regel, neben dem einen Deutsch, dem einen Französisch und dem einen Italienisch nicht in Frage. Am Sitz der Lia Rumantscha häuften sich die Anfragen und die Bitten um eine Übersetzung, mit der ganz Romanischbünden «angesprochen» werden könnte. So ist es kein Zufall, dass dort — auf der Lia Rumantscha — die Einsicht reifte, ein neuer Anlauf (nach bisher erfolglosen Versuchen), eine für alle Bündner-romanen gültige Schriftsprache zu schaffen, sei unabdingbar und dringend.
So geriet ich Ende 1981 ins Blickfeld des Sekretärs der Lia Rumantscha. Von der Notwendigkeit des Versuchs war ich leicht zu überzeugen, war aber der Meinung, es wäre Sache der Romanen selbst, in diesem Sinne tätig zu werden. Dagegen wurde eingewendet, jeder Rätoromane sei durch Abstammung und Herkunft mit einem einzelnen Teilgebiet Romanischbündens enger verbunden, und seine Objektivität würde daher zum vornherein angezweifelt. Dazu komme, dass bei den einheimischen Fachleuten die Lust, in den nicht eigentlich sauren, wohl aber gefährlichen Apfel zu beissen, ihre Grenzen habe —was man leicht verstehen kann, wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Angriffen unser Kollege Alexi Decurtins ausgesetzt war, als er in den sechziger Jahren die — vergleichsweise leichte Sünde beging, eine grammatische und orthographische Crux des Surselvischen zu beseitigen. Schliesslich kapitulierte ich vor diesen und ähnlichen Argumenten (und vor der Liebenswürdigkeit des Bittstellers) und erklärte mich bereit, es wenigstens einmal zu versuchen.
Der Zufall hat mir kürzlich ein Gedicht von Kurt Marti zugetragen, das genau zur damaligen Situation passt: «wo chiemte mer hi / wenn alli seite / wo chiemte mer hi / und niemer giengti / für einisch z'luege / wohi dass me chiem / we me gieng». Genau darum ging es: «einisch z'luege, wohi dass me chiem!» Niemand von uns wusste, wohin man kommen würde; auch ich wusste es nicht. Es war denn auch abgesprochen, dass meine Vorschläge unverbindlich sein sollten und, falls ungeeignet, in der Versenkung zu verschwinden hätten. Damit war mir klar, dass die ganze Übung nichts kosten durfte und das tat sie auch nicht.
Ende Februar 1982, sofort nach Semester-schluss, machte ich mich an die Arbeit; und sechs Wochen später war es soweit, dass ich eine erste Fassung meiner Vorschläge in Form eines Regelwerks, genannt «Richtlinien für den Aufbau einer gesamtbündnerromanischen Schriftsprache», den interessierten Kreisen vor-legen konnte. Sechs Wochen für eine so heikle und folgenschwere Arbeit? Meine Damen und Herren, musste da nicht ein erbärmlicher Pfusch herausgekommen sein? Gestatten Sie, dass ich Ihnen eine kleine Geschichte vorlese (meine Quelle ist ein Buch des Reiseschriftstellers Richard Katz). Da steht: «Es war einmal ein Kaiser von China, der einen berühmten Maler beauftragte, ihm auf den Thron einen Hahn zu malen. Der Maler ging und liess sich ein Jahr nicht blicken. Der Kaiser schickte einen mahnenden Boten. 'Ich bin noch nicht fertig', liess der Künstler dem Kaiser bestellen, und denselben Bescheid gab er nach zwei Jahren. Erst als drei Jahre um waren, stellte er sich ein und tuschte nun vor den Augen des Kaisers leichthin und flüssig einen Hahn auf den Thron. — 'Auf eine so leichte Arbeit hast du mich drei Jahre warten lassen?' fragte der Kaiser rügend doch auch wohlwollend, denn der Hahn war so treffend gemalt, als lebe er, und dabei doch schöner als irgendein lebender Hahn. — 'Komm zu mir, Sohn des Himmels, und du wirst mich verstehen', bat der Maler. Da liess sich der Kaiser zu dem Maler tragen und sah dessen Haus gefüllt mit lebenden Hähnen, soviel darin Platz hatten; ... und im Arbeitszimmer des Künstlers sah er einen grossen Haufen zerrissenen Reispapiers, auf das Hähne in vielerlei Stellungen getuscht waren. Auch gab es Blätter, die nur einen kleinen Hahnenteil zeigten, einen Fuss etwa oder gar nur eine Feder. —Da liess der Kaiser alle Hähne wiegen und ihr Gewicht dem Maler in Gold zahlen. Denn er er-kannte nun, dass ein gutes Aquarell zwar leichthin aussieht, aber nicht leichthin entsteht».
Ich weiss, dass ich zu hoch greife, wenn ich meine Arbeit zu einem Kunstwerk in Beziehung bringe, und das gilt auch nur mutatis mutandissimis. Einerseits gibt es grundlegende Unterschiede: Im Gegensatz zu dem chinesischen Maler bin ich zeichnerisch leider ganz unbegabt, das weiss ich selbst; und das Rumantsch Grischun ist kein Gockel, das wissen wir alle; ferner spielt unsere Geschichte nicht im Fernen Osten — unser Reich der Mitte heisst Graubünden; und so weiter! Aber daneben gibt es auch Parallelen. Zwar sind meine «Richtlinien» nicht innert Minuten mit ein paar genialen Pinselstrichen entstanden, sondern in vergleichsweise langen sechs Wochen. Aber hinter diesen sechs Wochen steht, ähnlich wie im Falle des chinesischen Aquarells, eine sehr viel längere Vorbereitungszeit. Bei mir waren es nicht drei Jahre, sondern deren etwa fünfundvierzig, denn schon als noch ganz grüner Gymnasiast, lange bevor ich zum erstenmal «rätoromanischen Boden» betrat (sofern es-das gibt), bin ich bereits der mysteriösen Attraktion des Bündnerromanischen erlegen und begann, autodidaktisch und amateurhaft, mich durch ein Idiom nach dem andern durch-zubeissen — eine anstrengende, aber auch lust-volle Tätigkeit. Später kam es zu einer professionelleren Beschäftigung mit der geliebten Sprache, und anno 1953 wurde ich Mitarbeiter am «Rätischen Namenbuch» unter der Leitung von Andrea Schorta. Dann war ich während rund fünfzehn Jahren Teilzeitredaktor am «Dicziunari Rumantsch Grischun» und während vierzig Jahren Mitglied und zeitweilig Präsident der Philo-logischen Kommission desselben Wörterbuchs. Das bedeutete, dass ich Hunderte von Korrektur-abzügen durchzusehen und auf Druckfehler und allfällige andere Mängel hin zu prüfen hatte —Berge von Papier, in denen sämtliche Idiome und sämtliche Ortsmuridarten Romanisch-bündens vorkamen, so dass ich schliesslich mit allen romanischen Wassern und Wässerchen gewaschen war. Endlich war Rätoromanisch in meinem Unterricht an der Universität zwar nicht das einzige, aber doch ein etwa alle drei bis vier Semester wiederkehrendes Thema. So verfügte ich denn im kritischen Moment des Jahres 1982 über eine gewisse Vorbildung für die unerwartete Aufgabe, und auch über einen ganz netten Stock von unmittelbar brauchbaren Notizen. Das ist der Hintergrund, aus dem sich die rasche Fertigstellung der «Richtlinien» erklärt.
Natürlich war es dann mit sechs Wochen Arbeit nicht getan, aber von da an war ich nicht mehr der Haupttäter, sondern nur noch Mitarbeiter, hatten doch die Romanen, wie ich immer gehofft hatte, inzwischen das Steuer selbst übernommen, und das funktionierte ausgezeichnet. Während ich mit dem Rumantsch Grischun beschäftigt war, konnte ich nicht ahnen, dass mir noch ein weit härteres Stück Arbeit bevorstand. Einige Jahre später wünschten Vertreter der Dolomitenladiner, dass ich auch für sie nach einer entsprechenden Lösung suche. Vom Dolomitenladinischen, das in fünf bis acht Varianten geschrieben wird, hatte ich damals erst ganz summarische Kenntnisse, und dort dauerte es denn auch nicht sechs Wochen, sondern volle sechs Jahre, bei intensiver Arbeit, bis meine Wegleitung bereit war. Auch dort erlebte ich im übrigen die Genugtuung, dass unverbrauchte jüngere Kräfte aus Ladinien das Konzept aufnahmen und nun mit grossem persönlichem Einsatz weiterführen.
Nun aber zurück zum Thema Rumantsch Grischun! Wie sollte man vorgehen, um zu einer für ganz Graubünden brauchbaren Schriftsprache zu gelangen? Das Einfachste wäre gewesen, einem der fünf schon bestehenden Schriftidiome die Würde einer übergeordneten Dachsprache zu verleihen. Aber welchem? Etwa dem zahlen-mässig stärksten, dem Surselvischen? Wer sich ein wenig auskennt, kann sich die Folgen leicht ausmalen: Grosse Teile Romanischbündens wären vergrämt worden, hätten sich ausgeschlossen gefühlt und wären in gewissem Sinne verloren. Die Äusserung eines Engadiners spricht hier Klartext: «Die Oberländer werden nie einsehen, dass das Engadinische das einzig richtige Romanisch ist» — das hat er mir schriftlich gegeben. Die gegenteilige Meinung aus der Surselva (dem Bündner Oberland) habe ich zwar nicht schriftlich, aber man darf getrost annehmen, dass sie leicht zu bekommen wäre. Das heisst, wie immer man gewählt hätte, es wäre falsch gewesen. Auch die während Jahren erprobte Vernunftlösung, nämlich Versuche mit dem Surmeirischen des Albula-Julia-Gebietes, das ja tat-sächlich eine vermittelnde Stellung zwischen den Blöcken einnimmt, hatte nicht die erhofften Resultate gebracht.
So kam ich denn bald zu der Einsicht, dass ein anderes Vorgehen eher aus der Sackgasse her-ausführen dürfte: nicht ein Idiom, sondern alle. Aber wie sollte man das anstellen? Konkretes Experimentieren ergab, dass sich die Arbeit vereinfachen liess (ohne damit das erstrebte Gleichgewicht zu gefährden), indem man sich auf die starken Eckpfeiler Unterengadin-Münstertal im Osten und Surselva im Westen abstützte und dort, wo diese divergieren, das mittelbündnerische Surmiran als Zünglein an der Waage entscheiden liess. In schwierigeren Fällen, wo diese Entscheidungsgrundlagen nicht ausreichten, wurden auch die Schriftidiome des Oberengadins und des Hinterrheingebietes und sogar die Lokalmundarten mit herangezogen, oder es gaben andere Kriterien als das der grössten Verbreitung den Ausschlag (z. B. bessere Verständlichkeit, Transparenz, morphologische Regelmässigkeit und Ähnliches).
Und das Ergebnis, ist das nun eine neue Sprache? Ja und nein. Nicht neu ist das Rumantsch Grischun insofern, als es im Prinzip nur Elemente enthält, die in Romanischbünden auf sogenannt «natürliche Art gewachsen» sind. Neu ist hingegen, jedenfalls zum Teil, die Kombination dieser Elemente. Arthur Baur, ein ausgezeichneter Sprachkenner (und Sprachenkenner) — vielen von Ihnen ist er bekannt als Verfasser des Buches «Allegra genügt nicht!» — hat die Formulierung geprägt, Rumantsch Grischun sei eine Variante des Bündnerromanischen, die sich spontan hätte entwickeln können, aber infolge besonderer Umstände nicht «von selbst» entstanden sei. Rumantsch Grischun, in dem Bestandteile verschiedener Idiome vereinigt sind, ist eine Ausgleichssprache. Solche Gebilde haben es heute schwer, gegen Vorurteile aufzukommen. Eine Ausgleichssprache, ist das denn etwas Böses, meine Damen und Herren? Ist es von Nachteil, wenn eine Schriftsprache, die ein grösseres Ge-biet abdecken soll, nicht auf einem einzigen Idiom beruht, sondern Merkmale aus mehreren Regionen vereinigt? Darf ich Ihnen verraten, wie eine der grössten Autoritäten, nämlich Dante Alighieri, sich zu dieser Frage geäussert hat? In seiner Abhandlung «De vulgari eloquentia» schreibt er, die ideale italienische Schriftsprache dürfe nicht identisch sein mit einer der zahlreichen Regionalsprachen Italiens, auch nicht mit dem Toskanischen, das er als «turpiloquium» (eine hässliche Sprechweise) bezeichnet; vielmehr müsse sie — die Schriftsprache — in sich vereinigen, was jede der Städte Italiens an edlen Sprachmerkmalen besitze, so dass sie (ich zitiere wörtlich) «omnis latie civitatis est et nullius esse videtur», das heisst «jeder italienischen Stadt gehört und keiner zu gehören scheint» (Kapitel 1,16.6). Und an anderer Stelle (1,15.5) lobt Dante ausdrücklich die «commixtio opposi-torum» (die Vermischung gegensätzlicher dialektaler Sprachzüge), wie sie im Bolognesischen festzustellen sei und diesem Idiom «laudabilem suavitatem» (etwa: einen lobenswerten Charme) verleihe.
Wer etwas näher zusieht, wird allerdings fest-stellen, dass Dante seine Theorie nur mangelhaft in die Praxis umgesetzt hat, dass in seinen italienischen Texten die toskanische Basis immer wieder durchschimmert. Die Schulmeinung, die italienische Schriftsprache beruhe auf dem Toskanischen, ist denn auch nicht wirklich falsch, aber sie ist allzu summarisch. Tatsächlich enthält die lingua nazionale viel mehr Untoskanisches (vor allem oberitalienisches) als sich die landläufige Schulweisheit träumen lässt.
Auch die Begründer der neuhochdeutschen Schriftsprache — zuerst die kaiserlichen und fürstlichen Kanzleien, dann Luther und seine Nachfolger — haben zum Teil beträchtlich gemischt, und so steht denn in der deutschen Hochsprache neben Mitteldeutschem vor allem recht viel Süddeutsches. Entsprechendes gilt aber für einen grossen Teil der etablierten Schriftsprachen Europas überhaupt: Die meisten sind, in unterschiedlichem Masse, Ausgleichs-, Misch- oder, in populärer Terminologie, sogenannte Kunstsprachen — nur hat man sich an diese «Kunst» (oder «Künste») seit langem gewöhnt. In der Schweiz zum Beispiel erstreckte sich die schrittweise Angewöhnung an die deutsche Standardsprache über rund dreihundert Jahre. In Romanischbünden aber stehen nicht mehr Jahrhunderte zur Verfügung, hier sollte es sehr viel rascher gehen. Ich verkenne keineswegs, dass dies hohe Anforderungen an die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft stellt, aber ich möchte nicht zögern, den Romanen die dazu nötigen Fähigkeiten zuzutrauen, um so mehr, als der Schritt von den Idiomen oder den Mundarten zum Rumantsch Grischun erheblich kleiner ist als etwa vom Schweizerdeutschen zum Schriftdeutschen oder gar vom Lombardischen zum Italienischen.
Mit einer inhärenten Problematik ist die Einführung des Rumantsch Grischun allerdings unweigerlich belastet — und damit komme ich zum Schluss: Ein konservatives Ziel, die Bewahrung der rätoromanischen Sprache, soll mit neuartigen, um nicht zu sagen revolutionären Mitteln erreicht werden. Daraus ergeben sich zwangs-läufig Spannungen: Leute mit eher konservativer Grundhaltung, an sich die besten Garanten der sprachlichen Tradition (und damit für das Fortleben des Romanischen) werden durch das unkonventionelle Vorgehen nicht selten verärgert; und umgekehrt sind neuerungsfreudige, besonders junge Romanen enttäuscht, wenn die anscheinend günstige Gelegenheit zu radikalen Verbesserungen (etwa der Schreibweise) mit Rücksicht auf jahrhundertealte Gewohnheiten —zum Teil schlechte Gewohnheiten! — nicht ergriffen wird. Dabei darf vielleicht als Trost gelten, dass die neue Schriftsprache keine unveränderliche Grösse ist, denn wie alles Lebendige verändert sich auch jede Sprache, solange sie lebt (nur sogenannte tote Sprachen bleiben unverändert). Dass sich auch das Rumantsch Grischun verändern werde, ist meine Hoffnung. Ich masse mir nicht an, bei allen Problemen immer die bestmögliche Lösung gefunden zu haben. Hier kann die Zukunft, sofern das Rumantsch Grischun eine hat, sehr wohl Besserung bringen und Abhilfe schaffen.