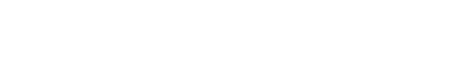1994 Hans Christoph Binswanger

Geboren am 19. Juni 1929 in Zürich. Studium der Volkswirtschaftslehre in Zürich und Kiel. Doktorat 1956 in Zürich, 1957-1967 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schweizerischen Institut für Aussenwirtschaft und Marktforschung an der Hochschule St. Gallen. 1967 Habilitation über «Markt und internationale Währungsordnung». Von 1969 bis zur Emeritierung 1994 ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Ab 1980 geschäftsführender Di-rektor der Forschungsgemeinschaft für National-ökonomie an der Hochschule St. Gallen. Bundes-naturschutzpreis (Bodo-Monstein-Medaille) 1980. Binding-Preis (Liechtenstein) für Natur- und Umweltschutz 1986. Ab Oktober 1992 bis 1995 Direktor des neu gegründeten Instituts für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG).
In Anerkennung seiner Pionierrolle beim Ein-bezug der Natur in geldtheoretischen Modellen.
Laudatio
Hugo von der Crone
Als Mitglied der Preiskommission der Stiftung Dr. J. E. Brandenberger hatte ich bei der Vorbereitung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den diesjährigen Preis Ihr Wirken, Herr Prof. Binswanger, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. — Nachdem der Stiftungsrat den Preis für 1994 Ihnen zugesprochen hat, darf ich heute auch einen wesentlichen Teil Ihres Lebenswerkes würdigen. Ich tue das besonders gern, fühle ich mich doch als Hobby-Imker mit der Natur seit dreissig Jahren sehr eng verbunden und hat mich doch diese Veranstaltung gezwungen, mich auch mit gewissen Grundfragen der mir eher fern liegenden Ökonomie näher zu befassen. Je mehr ich mich in Ihre Schriften vertiefte, desto stärker wurde mein Interesse. Vor allem Ihre pionierhafte Rolle als «Brückenbauer» zwischen Ökonomie und Ökologie hat nicht nur mich, sondern die ganze Preiskommission und schliesslich auch den Stiftungsrat fasziniert.
Lassen Sie mich diese Laudatio mit einem Zitat beginnen: «Im Ganzen gesehen handelt es sich darum, den durch die Geldwirtschaft über-forcierten Wachstumsprozess so zu steuern, dass die freien und freigesetzten Ressourcen (...) nicht unnütz verschleudert werden. Dies kann grundsätzlich auf zwei Weisen geschehen, entweder mit Hilfe einer die Marktwirtschaft ergänzenden Planung, das heisst mit Geboten und Verboten, oder aber durch Umstrukturierung der Marktwirtschaft, indem (...) die sparsame Verwendung der noch vorhandenen Ressourcen privatwirtschaftlich belohnt wird».
Woher stammen diese Worte? Sind sie aus der Feder des Bundesrates im Zusammenhang mit dem jüngsten Vernehmlassungsverfahren über eine CO2-Abgabe? Nein! Wurden sie 1983 im Leitbild der neu formierten Grünen Partei Schweiz niedergeschrieben? Nein! Das Zitat liegt noch weiter zurück. Es stammt bereits aus dem Jahre 1969, als Sie, Herr Binswanger, hier an der Hochschule St. Gallen Ihre Antrittsvorlesung hielten. Noch bevor der Club of Rome mit seinem Buch «Grenzen des Wachstums» die Weltöffentlichkeit aufrüttelte, widmeten Sie Ihre Antrittsvorlesung dem Thema «Wirtschaftliches Wachstum — Fortschritt oder Raubbau?». Sie erklärten da-mals zum erwähnten Zitat: «Vielleicht erhält mit dieser Aufgabe die Nationalökonomie sogar erst ihre eigentliche strategische Bedeutung.» Doch blenden wir noch etwas weiter zurück.
Ihr Interesse galt zunächst vor allem der europäischen Integration. Als Ökonom standen für Sie die mannigfaltigen wirtschaftlichen Aspekte im Zentrum. Schon sehr früh haben Sie aber gespürt, dass auch andere Elemente, eine Rolle spielen. Um die europäische Idee wirklich leben zu lassen, durfte der Graben zwischen dem Handeln der Politiker und dem Denken des Volkes nicht zu gross werden. Dem Föderalismus im kommenden Europa und der Stellung der Kleinstaaten galt daher Ihr besonderes Augenmerk. Dabei sollten aber auch Wirtschaft und Umwelt besser in Einklang gebracht werden. Sie forderten deshalb einen Übergang von der Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zur Wirtschafts- und Umweltgemeinschaft (EWUG). Und bereits im Jahre 1972 waren Sie der Meinung, dass sich die Umweltproblematik nur gemeinsam mit den Staaten in Osteuropa entschärfen lasse. Wie recht Sie hatten, zeigen die heutigen Ansätze einer umweltpolitischen Zusammenarbeit deutlich.
Schon früh befassten Sie sich auch mit der Landwirtschaft. Eine gemeinsame Agrarpolitik gehörte zum eigentlichen Kern der europäischen Integration. Die Erfahrung zeigte aber bald, dass die Einkommenssicherung für die Landwirte über höhere Preise in eine Sackgasse führen musste. Der Anreiz für eine stetige Erhöhung der Produktion zog eine teure Verwertung immer grösserer Überschüsse nach sich. Sie gehörten zu den Ökonomen der ersten Stunde, die eine konsequente Trennung von Preis- und Einkommenspolitik forderten. Damit wollten Sie nicht nur die ineffiziente Subventionswirtschaft stoppen, sondern namentlich die schädlichen Nebenwirkungen einer allzu intensiven Landwirtschaft auf die Umwelt reduzieren. Dass die Idee der Direkt-zahlungen rund zwanzig Jahre brauchte, um nun allmählich in die Praxis umgesetzt zu werden, hat Sie nicht verzweifeln lassen. «Gut Ding will Weile haben!»
Das trifft auch allgemein auf die Spannungen zwischen Wirtschaft und Umwelt zu, für deren Entschärfung Sie sich seit Ihrer Antrittsvorlesung beharrlich eingesetzt haben. Mit den «Grenzen des Wachstums» bewirkte der Club of Rome eine erste Phase der umweltpolitischen Sensibilisierung. Die Warnrufe basierten vor allem auf der absehbaren Verknappung natürlicher Ressourcen. Nachdem aber bei vielen Rohstoffen neue Vorkommen entdeckt sowie synthetische Herstellung und Rückgewinnung vorangetrieben wurden und nachdem ein harter Wettbewerb die Preise sinken liess, verstummten die Warnrufe wieder. Erst als sich das Abfallproblem von der Gewässer-verschmutzung auf die Belastung der Luft und die Verseuchung der Böden ausweitete, nahm das Interesse erneut zu. Heute hat der Umweltschutzgedanke den Durchbruch wohl endgültig geschafft. Damit meine ich jedoch nicht, dass keine weiteren Anstrengungen nötig sind. Der Prozess erscheint jetzt aber irreversibel.
Auf politischer Ebene brauchte es die Gründung spezieller Bewegungen, die sich des Umwelt-schutzes annahmen. Erst auf deren Druck hin setzte bei den etablierten Parteien jenes Umdenken ein, das eine Verankerung umweltpolitischer Ziele in den eigenen Leitbildern erlaubte. Bei manchen Unternehmern war noch bis vor nicht allzu langer Zeit der Spruch zu hören: «Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus.» Das ist heute anders. Aus pragmatischen Anfängen in der Betriebsökologie heraus ist die Erkenntnis gewachsen, dass Umweltschutz nicht nur mit Kosten verbunden sein muss. Er bietet vielmehr auch die Chance, mit langfristigen Investitionen Geld zu sparen und mit Produkten, welche die Umwelt weniger belasten, im harten Konkurrenzkampf eine Nasenlänge voraus zu sein. Das ist aber nur möglich, wenn bei den Verbrauchern die Bereitschaft zu einem umweltbewussteren Konsum wächst.
Dabei werden jedoch verstärkt die Grenzen der heutigen Umweltpolitik sichtbar. Insbesondere kommen wir mit Geboten und Verboten nicht weiter. Auch das haben Sie, Herr Professor Binswanger, bereits in Ihrer Antrittsvorlesung von 1969 angedeutet und in Ihren späteren Arbeiten vertieft. Die Idee marktwirtschaftlicher Instrumente im Umweltschutz ist also nicht neu. Sie musste jedoch zuerst reifen. Heute sind wir so weit, dass der Bundesrat einen konkreten Vorschlag für eine Lenkungsabgabe auf CO2-Emissionen präsentiert. Er ist zwar im Vernehmlassungsverfahren bei weiten Teilen der Wirtschaft noch auf Kritik gestossen. Diese ist jedoch nicht mehr grundsätzlicher Art. Bemängelt werden die fehlende Staatsquoten-Neutralität und eine ungenügende Rücksichtnahme auf besonders exponierte Branchen. Vor allem aber stellt sich die Frage der Opportunität eines Alleingangs der Schweiz. Wenn wir in Europa nicht vorausgehen wollen, dann sollten wir eine Lenkungsabgabe aber zumindest so weit vorbereiten, dass sie gleichzeitig mit der Europäischen Union realisiert werden kann.
Lenkungsabgaben stellen in der Umweltpolitik—ähnlich wie die Direktzahlungen in der Landwirtschaft — einen eigentlichen Quantensprung dar. Das gilt auch für Ihren schon im Jahre 1983 gemachten Vorschlag, eine Energieabgabe als Beitrag zur Rentenfinanzierung zu erheben. Damit haben Sie nebst der Umwelt einen weiteren, heute äusserst aktuellen Problemkreis angesprochen, nämlich die künftige Erfüllung sozialer Aufgaben durch unseren Staat. Die Finanzierung der sozialen Sicherheit beruht weitgehend auf Lohn-prozenten. Angesichts der demographischen Trends zeichnet sich mit dem derzeitigen System eine weiter zunehmende Verteuerung des Faktors Arbeit ab. Heute haben die Unternehmen einen Anreiz, Arbeit durch Maschinen und Energie zu substituieren — mit einer entsprechend erhöhten Umweltbeanspruchung und mit einer verringerten Zahl von Arbeitsplätzen. Mit Ihrem Vorschlag würde der Produktionsfaktor Energie verteuert und damit über die Zeit sparsamer eingesetzt. Gleichzeitig wäre eine Reduktion der Lohnnebenkosten möglich, was den Produktionsfaktor Arbeit verbilligt. Also zwei Fliegen auf einen Schlag? Die Idee fällt im heutigen Umfeld zunehmend auf fruchtbaren Boden. Wenn wir auch hier mit einem Reifeprozess von etwa zwanzig Jahren rechnen, dann liegt eine Realisierung zu Beginn des nächsten Jahrtausends durchaus im Bereich des Möglichen.
Diese wirtschaftspolitischen Vorschläge sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Sie basieren auf einer intensiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Wirtschaftstheorie. Und darin, Herr Professor Binswanger, liegt wohl Ihr besonderes Verdienst. Schon Aristoteles erkannte, dass eine ganz andere Wirtschaftsweise resultiert, wenn Geld nicht nur als Recheneinheit, sondern auch als Geldkapital mit einer selbständigen Rolle betrachtet wird. In der modernen Nationalökonomie, die auf Ldon Walras zurückgreift, ist dieser Ansatz leider verlorengegangen. Sie ist eine rein realwirtschaftliche Theorie; die Wirtschaft wird lediglich als Tauschmodell dargestellt. Hier setzt Ihre erste Kritik ein, indem Sie systematisch folgende Gegenthese begründen: — ich zitiere — «das Geld ist der alles dominierende Faktor der modernen Wirtschaft. Es erleichtert nicht nur den Tauschprozess, sondern entwickelt eine eigene Dynamik, die im entscheidenden Ausmass den Wachstumsprozess beeinflusst und verursacht». Basierend auf dem Geld und Kreditschöpfungs-prozess wird laufend investiert, weil man an das wirtschaftliche Wachstum glaubt; und dadurch kommt es tatsächlich zum erwarteten Wirtschafts-wachstum. Dabei werden jedoch immer mehr freie Güter der Natur im Produktionsprozess verbraucht. Eine dauerhafte Stabilisierung des Wirtschaftsprozesses ist in der modernen Geldwirtschaft nicht möglich, weil das Ausbleiben von Investitionen einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten einleitet. Damit stehen wir vor einem Dilemma: Wachstum der Wirtschaft und Schrumpfung der Natur oder Bewahrung der Natur und Schrumpfung der Wirtschaft.
Sie zeigen folgenden Ausweg aus diesem Dilemma auf. Um ein Wirtschaftswachstum unabhängig vom Naturverbrauch zu realisieren, muss die Natur unbedingt in das Preissystem einbezogen werden. Nur so kann die notwendige technologische Umorientierung stattfinden, die ein qualitatives Wachstum ermöglicht. Hier setzt auch Ihre zweite Hauptkritik der klassischen Nationalökonomie an. Sie berücksichtigt nämlich in ihrer volkswirtschaftlichen Produktionsfunktion lediglich die drei Faktoren Arbeit, Kapital und — als Restgrösse — den technologischen Fortschritt. Es fehlt die Natur als vierter Faktor. Das war früher anders, kam doch bei den Physiokraten im 18. Jahrhundert dem Produktionsfaktor Boden ein zentraler Stellenwert zu. Als notwendige Ergänzung zum marktwirtschaftlichen Einbezug der Natur postulieren Sie eine grundsätzliche Über-prüfung der Dynamik, welche dem modernen Geld- und Finanzsystem innewohnt.
Es kann hier nicht darum gehen, alle Aspekte Ihrer umfangreichen Forschungs- und Lehrtätigkeit im Bereich Wirtschaft und Umwelt vertieft auszuleuchten. Ich habe lediglich ein paar markante Punkte zu skizzieren versucht. Diese zeigen deutlich, dass Ihnen dabei eine eigentliche Vor-denkerrolle zukommt. Sie haben es wie kaum ein anderer verstanden
— frühzeitig zu erkennen, dass unsere traditionelle Wirtschaftsordnung ohne den Faktor Umwelt nicht komplett ist;
— die von der klassischen Nationalökonomie vernachlässigte Natur systematisch und umfassend in geldtheoretische Modelle einzubeziehen;
— klar aufzuzeigen, dass Ökonomie und Ökologie nicht wie Feuer und Wasser sind, sondern miteinander in Einklang gebracht werden können;
bereits in die nächste Geländekammer zu blicken, während Ihre Ideen den politischen Reifeprozess durchliefen;
— die Umweltdiskussion nicht in einen ideologischen Grabenkrieg ausarten zu lassen, sondern immer den Dialog zu suchen;
Ihre Studentinnen und Studenten für das Thema Umwelt zu sensibilisieren, sei es in Ihren Vorlesungen oder bei der Mitarbeit in Forschungsprojekten;
— auch einer breiteren Öffentlichkeit die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Umwelt verständlich zu machen.
Ich zögere keinen Moment, Sie daher als den eigentlichen «Brückenbauer» zwischen Ökonomie und Ökologie zu bezeichnen. Zusammen mit Kollegen anderer Disziplinen haben Sie ganz wesentlich dazu beigetragen, dass dem Umweltschutzgedanken der Durchbruch gelungen ist. Dafür gehört Ihnen unser aller Dank. Und deshalb hat Sie die Stiftung Dr. J. E. Brandenberger zum diesjährigen Preisträger erkoren. Sie sehen übrigens— bei uns müssen Sie nicht zwanzig Jahre warten wie bei der politischen Umsetzung Ihrer Ideen; die Stiftung besteht erst seit 1990! Wir wünschen uns sehr, dass Sie auch nach Ihrer kürzlichen Emeritierung noch möglichst aktiv bleiben werden. Das nicht zuletzt dank Ihrem Engagement neugegründete Institut für Wirtschaft und Ökologie an der HSG bildet dazu einen guten Nährboden.
Wirtschaftliches Wachstum - Fortschritt oder Raubbau?
Christoph Bisswange
Der Dr. J. E. Brandenberger Stiftung danke ich ganz herzlich für die Verleihung des Preises. Ebenso herzlich danke ich Herrn von der Crone für die Laudatio. Er hat meine Arbeit präziser um-schrieben, als ich es selber hätte tun können! Der Preis ist für mich ein mächtiger Ansporn und eine grosse Hilfe. Er ist Ansporn dazu, meine Studien voranzutreiben und meine immer noch bruchstückhaften Forschungsergebnisse zu einem Ganzen, zu einer Synthese zusammenzufassen. Und er ist eine Hilfe, um dies auch zu verwirklichen, denn ohne Unterstützung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Forschung und im Sekretariat kann ein grösseres Werk, wie sie eine solche Synthese naturgemäss darstellt, nicht, vor allem nicht in der für mich schliesslich nur noch knapp bemessenen Zeit, entstehen. Meinen eigentlichen Dank an die Stiftung werde ich dann in dem Ausmass abstatten können, als ich mit Hilfe des Preises meine Arbeit rascher vorantreiben und — so hoffe ich — auch vollenden kann. Sehr freue ich mich aber auch darüber, dass ich mit diesem Preis in die Fussstapfen von Kollege Hans Haug treten darf, der der erste Preisträger war. Er hat den Preis erhalten für seinen Einsatz gegen die Folter. Mit ihm habe ich, gemeinsam mit Kollege Riklin, eine schöne und intensive Zusammenarbeit erleben dürfen bei der Herausgabe des «Schweizerischen Handbuchs für Aussen-politik». Die Erinnerung an diese fruchtbare und oft auch recht vergnügliche Zusammenarbeit steigert noch den Wert des Preises.
Ich fühle mich nun aufgenommen in die «Dr.-Brandenberger-Familie» (wenn ich so sagen darf) zusammen mit allen bisherigen Preisträgern. Das ist für mich ein wesentlicher Teil des Preises!
Ein besonderes Anliegen ist es mir aber auch, an dieser Stelle der Hochschule St. Gallen meinen ganz grossen Dank auszusprechen für die Unter-stützung meiner Arbeit, die ich in vielfältiger Weise erfahren durfte und für die Freiräume, die sie öffnete für die Entwicklung neuer Denkansätze, zuletzt auch für die Gründung des Instituts für Wirtschaft und Ökologie! Eine solche Öffnung war alles andere als selbstverständlich. Ohne diese Unterstützung und diese Öffnung wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen. Mit dem Preis wird daher auch — darauf möchte ich besonders hin-weisen — die Hochschule ausgezeichnet.
Vor 25 Jahren hielt ich meine Antrittsvorlesung über das Thema «Wirtschaftliches Wachstum —Fortschritt oder Raubbau?» Wenn ich heute darauf zurückkomme, blicke ich auch zurück auf die Entwicklung meiner Arbeit an der Hochschule, die in hohem Ausmass von dem Thema der Antrittsvorlesung geprägt war.
Ich wurde oft gefragt, wie ich so früh auf die öko-logische Frage gestossen sei, zu einer Zeit, als sonst noch kaum davon die Rede war. Zweifellos lag die Beschäftigung mit dieser Frage 1969 doch schon in der Luft. Ein Jahr später, im Jahr 1970, erschien der sogenannte «Nixon-Bericht» über den Stand der Umwelt in den Vereinigten Staaten; es war der erste Umweltbericht überhaupt. Zwei Jahre später, 1971, schreckte der Report des Club of Rome über «Die Grenzen des Wachstums» die Welt auf. Es besteht kein Zweifel, dass an beiden Berichten schon 1969 gearbeitet worden war, so dass eben die Beschäftigung mit dieser Frage, wie gesagt in der Luft lag. Persönlich bin ich allerdings eher aufgrund einer wissenschaftlichen, einer theoretischen Frage auf dieses Thema gestossen. Wahrscheinlich wissen die meisten heute nicht mehr, dass der Begriff des wirtschaftlichen Wachstums damals in den 60er Jahren ganz neu war. Wohl hatten wir Studenten der Nationalökonomie im Studium ganz am Rande noch etwas von der postkeynesianischen Wachstumstheorie gehört, aber da ging es vor allem um die Interpretation des Konjunkturverlaufs, nicht um das Wachstum als solches. In den Zeitungen las man in Deutschland und in der Folge auch in der Schweiz vom wirtschaftlichen Wachstum erst in den 60er Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion um das sogenannte Stabilitätsgesetz in der BRD, das zur Lösung eigentlich aller wirtschaftlicher Probleme ein stetiges und angemessenes Wachstum postulierte, wobei «angemessen» hiess: inflationsfrei und konjunkturausgleichend, keineswegs aber «angemessen» in bezug auf irgendwelche öko-logischen Seiteneffekte. Das Wachstums-Postulat sollte im Prinzip nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt Geltung haben.
Damals fragte ich mich: ist ein solches Wachstum überhaupt möglich? Ich hatte doch in der Physik das Gesetz von der Erhaltung von Energie und Masse gelernt. Wie kann dann etwas immer wachsen, über das man real verfügen kann, das also durchaus physischer Natur ist, ohne dass etwas anderes weniger wird? Ich kam dann auf den Gedanken, dass die Lösung des Problems darin bestehen könnte, dass man das, was mehr wird, zählt, aber das, was weniger wird, nicht zählt und daher auch nicht ab-zählt, nicht abzieht. So verstanden, liess sich das stetige Wachstum des Sozialprodukts mit dem physikalischen Gesetz der Erhaltung von Energie und Masse vereinen.
Dies führte mich dazu, in meiner Antrittsvor-lesung die Frage zu stellen (ich zitiere): «Handelt es sich beim wirtschaftlichen Wachstum um eine Gewinngrösse, bei welcher der Aufwand bereits abgezogen ist, um einen Nettoertrag also, oder handelt es sich um eine Bruttogrösse, bei welcher der Aufwand ganz oder teilweise noch ab-gezogen werden muss, wenn man den Gewinn bzw. den Nettoertrag— nämlich die Erhöhung der Wohlfahrt, um die es doch schliesslich geht —erreichen will? Im letzteren Fall würde sich die Frage stellen, ob der Aufwand nicht den Ertrag schliesslich übersteigen, den Gewinn in Verlust verwandeln könnte, so dass anstelle des Fort-schritts der Raubbau dominieren würde? Handelt es sich also sozusagen um ein eindimensionales Problem, bei dem nur die eine Grösse, die Gewinngrösse errechnet werden muss, die dann zu maximieren ist, oder um ein zweidimensionales Problem, bei dem Ertrags- und Aufwand-grössen einander gegenüber gestellt werden müssen, so dass nicht eine Maximal- sondern eine Optimallösung zu suchen ist?»
Bei der Antwort bin ich damals davon ausgegangen, dass im Produktionsprozess tatsächlich ein Faktor mitwirkt, der ein reiner Wachstumsfaktor ist, weil er sich im Gebrauch nicht verbraucht, sondern sich im Gegenteil vermehrt, nämlich das Wissen und Können, hinter dem der menschliche Geist steht — das ist das qualitative Element, dass aber im übrigen das Wachstum des Sozialprodukts quantitativ weitgehend ein Substitutionsprozess ist. Während das Sozialprodukt steigt, werden die Vorräte an natürlichen Ressourcen abgebaut und verbraucht, sowie die Umweltqualität durch Abfälle und Emissionen verschlechtert. Wir stossen damit auf die Knappheit der Ressourcenvorräte und die Knappheit der Um-welt bzw. der Umweltmedien, bezüglich die Fähigkeit zur Absorption der Abfälle und Emissionen, ohne dass ihr in der Sozialproduktrechnung Rechnung getragen wird. Der Grund ist: in die Sozialproduktrechnung gehen nur Grössen ein, die bezahlt und somit in Geld bewertet werden. Weder der Besitzer der natürlichen Ressourcen noch der Verursacher von Umweltschädigungen muss aber für den Abbau der Ressourcenvorräte bzw. die Umweltschädigung etwas bezahlen. Die Umwelt wird vielmehr als freies Gut betrachtet, frei entweder für den Eigentümer der Ressourcen oder frei für alle, weil überhaupt kein Eigentümer vorhanden ist. Trotz der Möglichkeit eines steten Wachstums der Wirtschaft mit Hilfe des Faktors Geist, also durch Forschung und Entwicklung, geht es daher doch um ein Optimierungsproblem, das sich immer ergibt, wo Knappheiten auftreten. Es gilt dann, den Faktor Geist einzusetzen nicht nur für die Fortsetzung des Wachstumsprozesses, sondern auch und immer mehr für seine Optimierung. Dies ist allerdings schwierig, da der Ertrag monetär gemessen wird, während der ökologische Aufwand nur in naturaler Form erscheint.
Die Optimalaufgabe stellt daher zuerst einmal ein Messproblem dar: man darf das Augenmerk nicht allein auf das Sozialprodukt im bisherigen Sinne richten, sondern muss Indikatoren der Umwelt und Lebensqualität miteinbeziehen bzw. zusätzlich in Rechnung stellen.
Dies genügt aber natürlich nicht. Es müssen auch konkrete Massnahmen ergriffen werden — ich zitiere wieder meine Antrittsvorlesung — «um den durch die Geldwirtschaft überforcierten Wachstumsprozess so zu steuern, dass die sogenannten freien und freigesetzten Ressourcen, die heute in Wirklichkeit die knappsten Ressourcen sind, nicht unnütz verschleudert werden. Dies kann», so fuhr ich fort, «auf zwei Weisen gesehen, entweder mit Hilfe einer die Marktwirtschaft ergänzenden Planung, das heisst mit Geboten und Verboten, oder aber durch Umstrukturierung der Marktwirtschaft, in dem volkswirtschaftliche Kosten in privatwirtschaftliche umgesetzt werden bzw. die sparsame Verwendung der noch vorhandenen Ressourcen privatwirtschaftlich belohnt wird.» Es geht also um die Internalisierung der externen Kosten im weitesten Sinne. Ich schloss meine Ausführungen den Worten: «Hier mitzuhelfen dürfte die vornehmste Aufgabe des Nationalökonomen werden. Vielleicht erhält mit dieser Aufgabe die Nationalökonomie sogar erst ihre eigentliche strategische Bedeutung.»
25 Jahre sind seitdem vergangen. Es ist daher vielleicht an der Zeit, sich zu fragen, ob in diesem Vierteljahrhundert ökologische Kriterien in die Wirtschaft eingebaut worden sind. Haben die Postulate, die dazu führen sollen, Erfolg gehabt oder nicht? Ich möchte diese Frage wie folgt beantworten: Auch wenn es weiterhin offen ist, wohin sich die Welt entwickelt, ist es doch deutlich, dass mindestens in der industriellen Welt immer mehr Menschen das wirtschaftliche Wachstum nicht mehr als Maximalproblem im Sinne eines exponentiellen Wachstums, sondern als ein Optimalproblem im oben beschriebenen Sinne auffassen, so eben, dass Ertrag und ökologischer Aufwand einander gegenübergestellt werden müssen. Wir sprechen heute von einer nachhaltigen Entwicklung, mit der grundsätzlich diese Optimierung gemeint ist. Und wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass auch eine ganze Reihe konkreter Postulate, die damals aufgestellt wurden, verwirklicht worden sind oder vor der Verwirklichung stehen.
Es ist dabei oft sehr interessant zurückzuverfolgen, wo und wie Postulate in die Tat umgesetzt wurden. Dazu möchte ich aus meiner eigenen Erfahrung ein Beispiel geben. Ein besonderes Glück ist es, wenn man einen Vorschlag macht, der Kollegen nicht gefällt und sie ihm widersprechen, und wenn sich daraus eine Kontroverse ergibt. So machte ich 1970 in einem « NZZ»-Artikel einen Vorschlag zur Einführung von produktionsunabhängigen Direktzahlungen in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger (relativer) Senkung der Preise. Der Zweck war, Preis- und Einkommenspolitik zu trennen und so den mit der reinen Preispolitik verbundenen Anreiz zur Mengen-steigerung in der Landwirtschaft und den sich daraus ergebenden Umweltschäden zu mindern. Dieser Vorschlag missfiel dem damaligen Vertreter der Agrarwirtschaft an unserer Hochschule, Prof. Gasser, und er schrieb in der «NZZ» einen Gegenartikel. Darauf folgten noch Replik und Duplik. Dies hatte zur Folge, dass mein Vorschlag viel mehr Leser fand, als es ohne diese Kontroverse der Fall gewesen wäre. Zu diesen Lesern gehörte auch der damalige Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, Bundesrat Brugger. Er setzte sofort zur Prüfung dieser Frage eine Kommission ein — zuerst die sogenannte kleine, dann die sogenannte grosse Kommission Popp, genannt nach ihrem Vorsitzenden, Prof. Popp, Vizedirektor der Abteilung Landwirtschaft des Volkswirtschaftsdepartements in Bern. Die Idee der Direkt-zahlungen wurde dann auch im Parlament auf-gegriffen, im besonderen von Kollege Hans Schmid und Kollege Jaeger von unserer Hoch-schule. In der Folge wurde die Idee der Direkt-zahlungen tatsächlich in zwei Etappen realisiert. Zuerst wurden sie für die Berg- und Hügelland-wirtschaft eingeführt. Heute sind sie, wie Sie wissen, ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Landwirtschaftspolitik.
Dieses Beispiel lehrt erstens, dass man sich nicht ärgern, sondern freuen soll über Widerspruch und zweitens, dass man Geduld haben muss. Der Weg von der wissenschaftlichen Idee zur Realisierung, zur Verwirklichung in der Praxis, ist notgedrungen ein langer Weg!
Immerhin sind — wie gesagt — eine ganze Reihe von Postulaten verwirklicht worden oder sind auf dem Weg der Realisierung, angefangen von der ökologischen Berichterstattung, zu der Kollege Müller-Wenk an unserer Hochschule einen wesentlichen Beitrag unter dem Titel der ökologischen Buchhaltung geleistet hat, bis zur Einführung ökologischer Richtlinien für die Geschäftsführung in den Unternehmen, wobei ich — um bei unserer Hochschule zu bleiben — auf die Ausarbeitung der Lebenszyklus-Betrachtung der Produkte durch Kollege Dyllick verweisen möchte. Heute ist auch die Energiesteuer mit einem gleichzeitigen Abbau der Lohnnebenkosten ein Politikum geworden. Ich halte nach wie vor an diesem, in meinem im Jahr 1983 erschienenen Buch «Arbeit ohne Umweltzerstörung» vorgebrachten Vorschlag fest. Die St. Galler Postulate haben — dies ist selbstverständlich — nur einen kleinen Anteil an der Weiterentwicklung der ökologischen Idee. Es wären daher noch viele weitere Postulate zu nennen, die von anderen Stellen kommen und realisiert worden sind oder sich auf dem Weg der Realisierung befinden. Es handelt sich in neuer Zeit vor allem auch um Postulate für die Rio-Konferenz von 1992 bzw. um Postulate, die in der Folge davon formuliert wurden. Alle diese Postulate gelten selbstverständlich zusätzlich zur Umweltpolitik im traditionellen Sinne, die weiterhin ihre Bedeutung hat.
Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht nur um die politische Realisierung ökologischer Postulate geht, sondern auch und vor allem um ihre Aufnahme in die wirtschaftliche Praxis, die Praxis der privaten Haushalte und die Praxis der Unternehmen. Hier sind in letzter Zeit wesentliche Fortschritte erzielt worden, übrigens gerade auch im Bankenbereich, den ich mit Blick auf den Hauptredner dieses Vormittags speziell erwähnen darf. Wie ich feststellen konnte, nimmt das Interesse für ökologische Fragen in diesem Bereich, vor allem in der Bundesrepublik, man kann fast sagen explosionsartig zu, neuerdings auch bei kleineren Banken.
Trotz diesen und anderen Fortschritten dürfen wir allerdings nicht übersehen, dass Raubbau und Umweltbelastungen weitergehen und durch den neuen Wachstumsschub in der Dritten Welt —man denke nur an China — ganz wesentlich verschärft werden.
Kann die Idee der nachhaltigen Entwicklung sich dem gegenüber durchsetzen? Die Frage kann heute noch nicht beantwortet werden.
Ich meine aber, dass es für die künftige Entwicklung wichtig ist, dass die Wissenschaft, und vor allem auch die ökonomische Wissenschaft, sich weiterhin an der Ausgestaltung eines qualitativen Wachstums und darüber hinaus eines nachhaltigen Wirtschaftens beteiligt. Dies bedingt zweierlei: Verankerung der Vorschläge in einer tragfähigen Grundkonzeption und eine Vertiefung der Analyse.
Persönlich halte ich an der Grundkonzeption fest, die ich in meiner Antrittsvorlesung formuliert habe: die Erweiterung der Marktwirtschaft durch «Einbezug der volkswirtschaftlichen Kosten» in die Preise, also — ich wiederhole es — um eine Internalisierung der externen Kosten im weitesten Sinne des Wortes. Es geht nicht nur um die Berücksichtigung der Belastungskosten durch einzelne Emissionen von Schadstoffen, sondern auch um den Ersatz umweltbelastender durch umweltentlastende Steuern, etwa im Sinne der Energiesteuer zusammen mit einem Abbau der Lohnnebenkosten. Es geht aber auch um den Abbau von Subventionen, die zur Umweltbelastung führen, z.B. im Verkehrs- und Abfallbereich; dadurch können gleichzeitig die Staatsausgaben verringert werden. Diesbezüglich wird noch viel zu wenig getan. Die Marktwirtschaft ist ein Preis- und kein Subventionssystem. Dies muss immer wieder hervorgehoben werden. Die Umwelt kann schon dadurch geschützt werden, dass ihre Schädigung nicht weiterhin vom Staat finanziert wird!
Was die weitere wissenschaftliche Analyse an-belangt, so werde ich auch in Zukunft die Linie verfolgen, die in die Begründung der Preisverleihung aufgenommen wurde: der Einbezug der Natur in geldtheoretische Modelle.
Das rasche wirtschaftliche Wachstum hat die Belastung der Umwelt zur Folge gehabt. Das Wachstum wird weltweit weitergehen. Man kann sich ihm nicht entgegenstellen. Aber man kann es in eine umweltschonende Richtung lenken. Das, meine ich, ist machbar, gemäss dem Wort von Johann Christoph Lichtenberg, «Eine Wirkung völlig zu hindern, dazu gehört eine Kraft, die der Ursache von jener gleich ist, aber ihr eine andere Richtung zu geben, bedarf es öfters nur eine Kleinigkeit». Dies mag etwas untertrieben sein, aber: versuchen wir es — weiter!
Auf dem heutigen Kalenderblatt habe ich gerade das italienische Sprichwort gelesen: «La constanza sempre avanza» — «Beharrlichkeit gewinnt». Dieser Spruch mag auch unsere Devise sein für den Weg in die Zukunft!