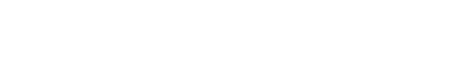1993 Reni Martens Walter Marti

Reni Mertens wurde am 8. April 1918 in Zürich geboren. Sie studierte Romanistik in Zürich und Genf. Danach unterrichtete sie, untertitelte Filme und machte Übersetzungen.
Walter Marti wurde am 10. Juli 1923 in Zürich geboren. Kindheit in Belgien und Italien. Nach dem Studium der Romanistik, Kunstgeschichte und Geschichte war Walter Marti als Journalist, Übersetzer und Redaktor tätig. Er verstarb am 21. Dezember 1999.
1953 gründeten Reni Mertens und Walter Marti die Teleproduction. Zusammen förderten sie Schweizer Filmemacher.
Gemeinsame Filme: Le Pelé (1963), Ursula oder das unwerte Leben (1966), Die Selbstzerstörung des W. M. Diggelmann (1973), Gebet für die Linke — Dom Helder Camara (1974), A propos des apprentis (1977), H6ritage (1980), Pour écrire un mot (1988), Requiem (1992).
Auszeichnungen: Goldener Sesterz des Internat. Filmfestivals Nyon für das Gesamtwerk, 1987 Züricher Filmpreis, 1989 Preis der Schweiz. Doron-Stiftung.
In Anerkennung ihres wegweisenden dokumentarfilmischen Werkes, ihrer selbstlosen Förderung des schweizerischen Filmschaffens, ihrer Treue zum Ideal der Humanität und ihrer tätigen Gebe zum Mitmenschen.
Laudatio
Beat Sitter-Liver
Es gibt viele Aspekte, unter denen sich das dokumentarfilmische Schaffen von Reni Mertens und Walter Marti, aber auch ihr Wirken als Förderer von Kollegen und des Schweizer Films überhaupt, beleuchten liessen, um so die Zuerkennung des Brandenberger-Preises zu begründen. Manches ist bereits geschrieben worden, jüngst aus Anlass von Walter Martis siebzigstem Geburtstag. Pro Helvetia hat zweimal ein ansprechendes Dossier über Mertens-Marti herausgebracht, 1983 in deutscher Sprache, eine überarbeitete und erweiterte Fassung 1989 auf französisch. Diese Literatur ist leicht zugänglich. Dies wissend, werden Sie mir gestatten, mich auf wenige Aspekte zu beschränken und insbesondere im Biographischen bei einer groben Skizze zu bleiben.
Renata Mertens-Bertozzi kam 1918 in Zürich zur Welt. Ihre Mutter stammt aus Oberitalien, gelangte, nach einer an Schicksalsschlägen nicht armen Jugend, mit zwölf Jahren selbständig nach Basel, wo sie zur Schneiderin ausgebildet wurde. Der Vater, mit einer nicht minder bewegten Jugend in der Romagna, wurde, nachdem er beim Tunnelbau durch den Simplon mitgewirkt hatte, Coiffeur in Zürich. Hier eröffneten die Eltern Bertozzi ein Geschäft für Früchte- und Gemüseimport. Zuhause sprach man natürlich Italienisch. Die—zum Teil unsanft aufgezwungene —Auseinandersetzung mit der anderssprachigen Umwelt festigte zusätzlich die insbesondere von der Mutter getragene familiäre Solidarität sowie die Bindung an die lateinische Kultur. Renata Bertozzi, wissenshungrig und entsprechende Leseratte, konnte das Gymnasium besuchen. Sie bestand zuerst die Wirtschafts-, dann die klassische Matura. In Genf und Zürich studierte sie romanische Sprachen und Literatur, promovierte 1949 mit einer Arbeit über den «Antirealismus von Gabriele d'Annunzio». Unterricht, Untertitelung von Filmen, Radiosendungen, Übersetzungen ins Italienische, so die theoretischen Schriften von Berthold Brecht oder Max Frischs «Santa Cruz», folgten. Schon während ihrer Studienzeit führte sie einen Diskussionszirkel, in dem Leute wie Lucien Goldmann, Georg Lukacs, Emmanuel Mounier, Ignazio Silone auftraten. Entscheidenden Ein-fluss auf sie wie auf Walter Marti, dem sie an der Universität und dann in ihrem Zirkel begegnet war, hatte die Freundschaft mit Bert Brecht, dem sie während seines Zürcher Aufenthalts Gastrecht gewährte. — Walter Marti wurde ihr wichtigster Partner in intellektueller Analyse und schöpferischem Gestalten. Zentrales Motiv für die Arbeit mit ihm blieb, den Film in den Dienst jener zu stellen, denen selber die Sprache fehlt: Behinderte, Randfiguren. Sie will so jenen nahe-bleiben, die, wie ihre Familie, emigrieren und anderswo ihre Lebensbedingungen sichern mussten.
Walter Marti, obwohl 1923 in Zürich geboren, ist tief in der lateinischen Kultur verwurzelt: Waadtländerin war seine Mutter; zu Hause sprach man französisch. Sein Vater, zum protestantischen Pfarrer ausgebildet, frönte als Wirtschafts- und politischer Korrespondent in Brüssel seinen journalistischen Neigungen. Der «Neuen Zürcher Zeitung» und der «Frankfurter Allgemeinen» zu prononciert antinazistisch, musste er seine Arbeitswelt in Belgien mit der Betreuung der Schweizer Kirche in Genua vertauschen. Wegen des Abessinienkrieges aus Italien heimgekehrt, siedelte sich die Familie in Yverdon an, wo der Vater, zugleich Romancier und Stückeschreiber, die deutschsprachige Gemeinde betreute. Benno Besson brachte W. Marti zum Theater. In der Truppe lernte Marti Suzanne Paschoud kennen, die seine Frau wurde. — Die Matur gelang nicht in Lausanne, in Zürich, später, doch. Dazwischen liegt Erwerb als Land- und Fabrikarbeiter. Das Romanistik-studium in Zürich weicht der Arbeit als Journalist und Redaktor in Presse und Radio. Dann «ruft» der Film: Statist, kleine Rollen, Werbetexter, Kommentator, Untertitler — Stationen auf einem Weg, der zur Freundschaft mit Vittorio de Sica und, vor allem, mit Cesare Zavattini führte. Die Leitung der Abteilung Film beim Schweizer Fernsehen vermochte ihn nur gerade acht Monate zufriedenzustellen. Seine Ideen und Überzeugungen — zum Beispiel der Vorrang von Direktsendungen in der Informationsabteilung — vertrugen sich nicht mit den gängigen und offiziellen Ansichten und Erwartungen. Reni Mertens und er, seit langem «gemeinsam denkend», machten sich auf den eigenen Weg, auf dem ein eindrückliches und einzigartiges Werk entstand. Es ist ein Werk, wiewohl in zwei ganz unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten festgemacht. Die Filme sind, wie beide bestätigen, Produkte von Diskurs, Vermittlung und Versöhnung, welchen zuweilen Streit, Gewalt und Verzweiflung vorhergingen. Gründe zu analysieren, denen sich diese Einheit letztlich verdankt, fehlten und fehlen Zeit und Gelegenheit. Eines indessen soll hervorgehoben werden: dass hier aus dem ganz selbstverständlich erscheinenden Zusammenwirken einer Frau und eines Mannes, beide verbunden durch Freundschaft, Solidarität, Vertrauen und gemeinsame Ziele, ein hervorragendes kulturelles Werk entsprungen ist. Warum dies besonders betonen? Weil wir in einer Zeit leben, da es zu leicht noch geschieht, dass die Geschlechter voneinander ab-gehoben und, im Hinblick auf gesellschaftliche, politische und überhaupt kulturelle Ziele, gegeneinander ausgespielt werden. Nicht einfach eine Frau oder ein Mann bzw. die eine im Gegenzug zum anderen auszuzeichnen, sondern ein Paar zu ehren, bereitet daher besonderes Vergnügen. Nehmen Sie es als einen Beleg dafür, dass aus dem Wechselspiel unterschiedlicher Anlagen und Kompetenzen, aus der Dialektik gegensätzlicher Sichtweisen, Tendenzen und Verfahren das hervorgeht, was kulturell besonders wertvoll ist, was Wege für die Bewältigung der grossen geschichtlichen Aufgaben, durch die wir alle herausgefordert sind, zu weisen vermag. «Den Menschen, den konkreten einzelnen Menschen, und das auch dort, wo Gesellschaft und Politik sein Schicksal sind, mit ihren Filmen entdecken, ihn beobachtend, darstellend und aufklärerisch in seinem Eigentlichen ausfindig machen: Darin besteht der Sinngehalt der Filme von Walter Marti und Reni Mertens.» So schrieb Martin Schlappner vor wenigen Monaten in der «Neuen Zürcher Zeitung» (Nr. 156, 9.7.1993, S. 53). Und in der französischen Fassung des Pro-Helvetia-Dossiers über Mertens-Marti schliesst Franz Ulrich seine schöne Würdigung mit der Bemerkung: «La phrase de Pestalozzi: 'L'homme peut et veut ce qui le rend mei Ileur, plus digne d'amour et d'estime' r6sume toute l'oeuvre de Reni Mertens et Walter Marti, un cinema engagé, pour la dignité de l'homme» (1989, S. 28). Ich möchte, was Schaller und Ulrich als Wesenszug im Schaffen der beiden Geehrten herausheben — und wer vermöchte solches treffender als die beiden Freunde! — in einem etwas anderen Lichte betrachten, wenn ich versuche, das hauptsächliche Verdienst der beiden Dokumentarfilmer zu vergegenwärtigen. Was mich besonders berührt, ist beider entschiedenes Eintreten für die Überzeugung, dass jeder Mensch auf sein mögliches Bestes hingeführt werden kann, dass es mithin unter keinen Umständen angeht, bestimmte Formen menschlichen Da-seins als nicht lebenswert abzutun. Dieses Prinzip geht allen im Einzelfall vielleicht angezeigten Differenzierungen vor. Der Film «Ursula oder das unwerte Leben», vor bald dreissig Jahren entstanden, verkündet diese Überzeugung in überwältigender Weise. Sie erinnern sich: Dokumentiert wird, wie ein medizinisch als geistesschwach, stumm, taub und blind, infolge-dessen als nicht entwickelbar qualifiziertes Mädchen dank Geduld und liebevoller Zuwendung zu Weltoffenheit und Lebensfreude er-weckt wird. Diese überträgt sich nicht nur auf jene, die sich des Mädchens vernünftig und pflegend annehmen; sie verwandelt auch uns Zuschauer und macht uns bereit, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen und bisherige Verhaltens- und Versorgungsweisen als Versäumnisse zu erkennen. Was Ursula widerfährt, findet Echo und Verstärkung in der Darstellung paralleler Schicksale. In knappen Sequenzen wird auf gerade wegen der Kürze der Szenen vielleicht noch eindrücklichere Weise hervorgehoben, dass Ursula kein Sonderfall ist. Entsprechend grosse Wirkung zeitigte der Film: Eltern behinderter Kinder schlossen sich zusammen, Podiumsdiskussionen wurden abgehalten, Betroffene wagten es, ihre Sorgen auszusprechen. Es kam zu Veränderungen und Verbesserungen in Heimen und psychiatrischen Krankenhäusern; rhythmisch-musikalische Erziehung gewann an Bo-den, sie wurde als eine ideale Hilfe in der Erziehung behinderter Menschen erkannt, in heilpädagogische Ausbildungsgänge eingebaut und in therapeutischer Praxis umgesetzt. Dem dokumentarfilmischen Wurf der von einem tiefen pädagogischen, durch die Gedanken Pestalozzis genährten Eros beseelten Künstler war eine breite gesellschaftliche Wirkung beschieden.
Rufen wir uns die aktuelle Diskussion um Sinn und Unsinn der pränatalen Diagnose ins Gedächtnis. Vergegenwärtigen wir uns die Möglichkeit eugenischer Massnahmen, welche mit den aufsehenerregenden biomedizinischen, ins-besondere gentechnischen Methoden erschlossen werden; denken wir an die kaum mehr zu bewältigenden ethischen Schwierigkeiten, in die uns diese neuen diagnostischen und therapeutischen Mittel hineinführen, sodann an den Protest, gerade von seiten der Behinderten, welche einschlägige Thesen des australischen Moralphilosophen Peter Singer auslösten; dann liegt die Vermutung nahe, Mertens-Martis ergreifender Film könnte für unsere Gesellschaft auf neue Weise wegweisend werden.
Menschenliebe ist für Reni Mertens und Walter Marti nicht nur Programm, sondern vielschichtige Praxis. Um nochmals auf den Film «Ursula» zu sprechen zu kommen: Ursula ist kein Star, mag auch der Film ihren Namen tragen. Der Fa-den ihrer Geschichte verliert sich von Zeit zu Zeit, muss immer wieder aufgenommen werden. Thematik und künstlerische Gestaltung bilden den einheitlichen Rahmen, innerhalb dessen mehrere Kurzgeschichten erzählt werden. Verschiedene Personen rücken in den Vorder-grund. Allen wendet die Kamera, wenden die Autoren ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu. Er-greifend ist es für den Zuschauer zu erleben, mit welcher grossen Achtung Mertens-Marti noch dem scheinbar geringsten Mitwirkenden, dazu zählen auch unbelebte künstliche und natürliche Gegenstände, Landschaften etwa oder Elemente, begegnen. Damit stimmen sie uns nachdenklich. Das, was uns geläufig ist, besitzt für uns in der Regel ganz selbstverständlich den Vorzug gegenüber Fremdem. Mertens-Marti bringen es dank ihrer Umsicht, Behutsamkeit und eben Achtung zustande, dass uns das Unvertraute als das Selbstverständliche erscheint. Das verwirrt, führt, wenn wir uns nicht verschliessen, zur Selbstbefragung, dann zu Toleranz und Anerkennung auf dem Grunde jener Achtung, die wir von Mertens-Marti unversehens übernommen haben. So sind wir, haben wir uns das jüngste Werk der Geehrten zu Gemüte geführt, den im Süden von Burkina Faso gedrehten Film «Pour écrire un mot», durchaus nicht sicher, wie weit für Alphabetisierung plädiert wird und nicht vielmehr traditionelle Lebens- und Erziehungs-formen als existenziell angemessen in den Vordergrund gerückt werden. Zweierlei steht aller-dings zum Schluss unzweifelhaft fest: der Eigenwert und die Schönheit jener Lebensformen, die Mertens-Marti gleichberechtigt neben andere, beispielsweise unsere Weisen des Lebens und Erziehens stellen.
Lassen Sie mich auf einen bisher — so weit ich sehe — wenig bedachten Aspekt im Schaffen von Mertens-Marti zu sprechen kommen. Schon die frühen Filme zeichnen sich durch lange Einstellungen aus. Was sich bewegt, ist allenfalls der Gegenstand, das Ereignis, dem sich das sonst fixe Objektiv öffnet. Die Sequenzen werden zuweilen fast zerdehnt — fast nur, denn gerade noch rechtzeitig wechselt jeweils das Bild. Lange genug freilich sind wir Betrachter hingehalten worden, um uns fragen zu müssen, was eigentlich geschehen sei, warum wir eindringlich mit einem bestimmten Ausschnitt aus dieser unserer Welt konfrontiert wurden. Wir entdecken, bald, dass Mertens-Marti uns ausreichend Zeit gewähren wollten, damit wir uns auf das einlassen, was sie uns vorführen; damit wir uns sorgfältig umsehen, um uns zu wundern, um uns angehen, betroffen machen zu lassen.
Es mag faszinierend sein, bei einer Sequenz verweilen, sie auskosten zu dürfen. Es kann aber auch schmerzhaft werden, die Dauer einer bestimmten Einstellung aushalten zu müssen. Ungeduld regt sich dann bald. Denken wir später über solche unausweichlichen, weil mit konsequenten gestalterischen Mitteln zielsicher herbeigeführten — Erlebnisse nach, realisieren wir, was uns widerfahren ist: Wir sind zum Verweilen angehalten worden, zur Konzentration. Gegen den sonst stürzenden Fluss der Zeit hat man uns Langsamkeit aufgedrängt. Zur Geduld wurden wir genötigt, immer wieder, damit zur Geduld erzogen. Und ich meine, dass wir dadurch ein menschliches Mass im Umgang mit der Zeit wiedergewonnen haben, wenn vielleicht auch nur vorübergehend. Denn die Eilfertigkeit und Betriebsamkeit, in deren Strudel wir alltäglich geraten, die auch unsere Nächte und unsere Ruhe kürzt, wenn nicht raubt, bekommen uns schlecht. Etwas Menschenfeindliches hängt ihnen an. Sie erschweren zumindest Besinnung und Entscheidungen, die in umsichtiger, wertender Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und Mitwelt getroffen werden. Sie laufen der Arbeit an innerer Beständigkeit zuwider, höhlen mit dieser die Voraussetzung verantwortlicher Existenz aus. Das wird zu wenig bedacht. Zwar wird beschrieben und akkurat analysiert— in der Managementliteratur etwa —, wie sehr die Möglichkeiten der Technik, der mit diesen verhängte soziale Wandel, der von ihnen abhängige wirtschaftliche Wettbewerb, insbesondere der Zwang zu immer kurzfristigeren Innovationen unser Tun und Sorgen bestimmen. Im übrigen wird, was solcher Analyse unterliegt, als Faktum hingenommen. Selten hören wir, was doch offensichtlich ist: dass uns solch rasante Entwicklungen kaum mehr den Atem lassen, den wir brauchen, um selber entwickelnd voraus- oder Veränderungen, die uns wie Naturereignisse überkommen, nachzulaufen. Nicht gefragt wird, ob Geschwindigkeit und Betriebsamkeit etwas anderes sind als kulturelle Verhaltensmuster, mit denen wir einen unbezahlbaren Verlust zu überspielen suchen: den Verlust von tiefwirkenden Werterfahrungen und Werteinsichten, die uns erst erlauben, wirklich menschlich da zu sein, das heisst besonnen und für Anderes offen, nicht bloss getrieben und an kurzfristig-materielle Zwecke gekettet.
Die Arbeiten von Mertens-Marti lassen Zeit, er-heischen Geduld, lehren Distanz nehmen, wecken Besinnung, führen, unterschwellig zwar, an Verantwortung und Entscheidung heran. Sie bieten ein Mittel gegen die skizzierte Krankheit des Gängigen, Therapie für eine — zu selten als solche wahrgenommene — weitverbreitete Behinderung. Auch in dieser Weise sind die beiden Preisträger in ihrer Arbeit seit Jahrzehnten der Menschlichkeit verpflichtet.
Reni Mertens und Walter Marti haben nicht nur selber zur Meisterschaft im Dokumentarfilm gefunden, sie haben diese Filmsparte auch bei an-deren und institutionell nach Kräften gefördert. Wie sie überhaupt seit den fünfziger Jahren für das Heranwachsen und das Blühen des sogenannten Neuen Schweizer Films Wichtiges geleistet haben, wiederum auf persönlicher wie auf institutioneller Ebene. Mit dem Branden-berger-Preis soll auch dieses Verdienst ausdrücklich Anerkennung finden.
1953 etablierten die beiden sich als Produzenten, mit der Gründung der bis zum heutigen Tage in Zürich angesiedelten «Teleproduction». Die Firma diente zunächst der Realisierung eigener Projekte, wurde aber schon bald zum Ort, an dem andere Filmgestalter Rückhalt und Unterstützung fanden, um ihre eigenen Wege zu gehen — Wege eben, die zum Neuen Schweizer Film führten. So produzierten Mertens-Marti 1964 den ersten langen Film von Alain Tanner. «Les apprentis» ist der Ausgangspunkt einer Karriere, die Tanner zum international bekanntesten Filmschaffenden der Schweiz machte» (F. Ulrich 1983, 21). Vier Jahre später steckten sie die — im Vergleich mit dem Aufwand, den sie selber während acht Jahren hatten treiben müssen, lächerlich geringen — 35'000 Franken, die ihnen der Bund als Qualitätsprämie für den Film «Ursula» zusprach, in die Produktion von Rolf Lyssys erstem Spielfilm «Eugen heisst wohlgeboren». Anders als später dem Film «Die Schweizermacher» blieb der Komödie der Erfolg versagt. Mertens-Marti hingegen setzte die Produktion auf einen Schuldenberg, der sie während fünf Jahren hinderte, selbst als Autoren oder für andere als Produzenten aufzutreten. Vom Bund kam keinerlei Hilfe; erst ab 1969 liess das Filmgesetz auch die Förderung von Spielfilmen zu. Die Selbstlosigkeit von Mertens-Marti nahm deswegen keinen Schaden. Die «entmutigenden Erfahrungen mit der Produktion von Filmen anderer haben die beiden nicht resignieren lassen. Sie unterstützen immer wieder junge Talente, geben ihnen Arbeit und Ratschläge und setzen sich mit ihren Projekten kritisch auseinander. Es gibt so etwas wie eine Marti-Mertens-Schule.» So Franz Ulrich im Dossier aus dem Jahre 1983 (S. 23). Verdienste erwarben sich Mertens-Marti auch bei der Schaffung von für den Schweizer Film wichtigen Institutionen. Sie gehörten zur Kerngruppe, die sich im Jahre 1961 um Henri Brandt sammelte, um den Verband Schweizer Filmgestalterinnen und Filmgestalter zu gründen (9.10.1962) und die Schaffung einer Grundlage für die Filmförderung durch den Bund, das Bundesgesetz über das Filmwesen, (18.9.1968) voranzutreiben.
Im Rückblick auf das grosse Engagement von Reni Mertens und Walter Marti als Produzenten, Verbandsmitglieder und Filmpolitiker stellt Franz Ulrich fest: «Marti-Mertens haben sich immer wieder für jene eingesetzt, die nicht im Trend liegen, nicht modisch sind, die Nase nicht im Wind und keine Lobby haben — die Jungen, die Aussenseiter, die Unbequemen, die Querulanten. Das macht sie bei Bürokraten und Mischlern aller Art verdächtig und unbeliebt. Und eine gewisse Tragik besteht darin, dass Marti-Mertens häufig zusehen müssen, wie andere von dem profitieren, wofür sie gekämpft haben» (1983, S. 21). Die Ehrung der beiden heute, so hoffe ich, schafft hier etwas Ausgleich. «Liebe Preisträger — Frau und Mann in einem.»
Dieser Gruss stand am Anfang meiner Würdigung. Reni Mertens und Walter Marti bilden in der Tat ein Paar — «jamais du même avis sur rien, mais toujours d'accord sur les objectifs», sagt er. Früchte trägt ihr ganz auf den Dokumentarfilm ausgerichtetes Wirken, weil gemeinsame Ziele und Überzeugungen es leiten. Familien jedoch haben beide Partner getrennt gegründet, aufgebaut und mitgetragen. Dass so zwei sich ergänzende, vermutlich zuweilen aber auch in Spannung zueinander stehende persönliche Beziehungsnetze möglich wurden, liegt keineswegs auf der Hand. Es scheint mir darum angemessen, wenn wir zum Schluss, wenigstens für einen Augenblick, den anderen Lebensgefährten von Reni Mertens und Walter Marti, den Gatten wie den Kindern, unsere Aufmerksamkeit schenken. Sie brauchten Verständnis und Grossherzigkeit, um die beiden Preisträger ein Paar in der Arbeit bleiben zu lassen. Es fehlte nicht an Solidarität und tatkräftiger Unterstützung, auch in finanzieller Hinsicht. Dafür gebührt auch ihnen herzliche Anerkennung.