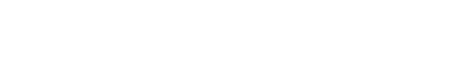1991 René D. Haller

Geboren 1933 in Lenzburg. 1941-1950 Schu¬len in Lenzburg. 1950-1953 Lehre als Gärtner und Landschaftsgestalter in Brugg. 1953-1954 Kurs für Tropenagronomie am Schweizerischen Tropeninstitut in Basel. 1956-1959 Manager einer Kaffeeplantage in Tanganjika. 1959 Leiter der Landwirtschaftsabteilung der Bamburi Port-land Cement Co. Ltd. in Mombasa, Kenia. Seit 1982 Direktor und Leiter der Baobab Farm Ltd., einer Tochtergesellschaft der Bamburi Portland Cement Co. Ltd. in Mombasa.
1987 Auszeichnung mit der «Global 5000 Roll of Honour» des United Nations Environmental Programme (UNEP) für die Rehabilitation und Wiederbegrünung des grossflächigen Kalkstein-bruchs der Zementfabrik in Mombasa.
Für seinen beispielhaften Einsatz als Ausland-schweizer in Afrika und seine wegweisende Entwicklungshilfe nach umweltgerechten Grund-sätzen.
Laudatio
Markus Mattmüller
Der Mann, den wir heute ehren, hat sich im Sinne der Stiftungsurkunde «um das Wohl der Menschheit verdient gemacht». Ich habe die Aufgabe übernommen, sein Lebenswerk zu würdigen, so gut ich das eben aufgrund von Literatur und von Informationen tun kann, die mir von Bekannten und Freunden René Daniel Hallers zugekommen sind. Zum Glück wird der Preisträger uns nachher die spannende Geschichte seiner Entdeckungen selber erzählen.
René D. Haller lebt seit 35 Jahren in Afrika und arbeitet seit 1959 in Kenia, wo er zunächst die Bodenreserven der Zementfabrik von Mombasa landwirtschaftlich nutzen und die Arbeiterschaft mit Fleisch und Gemüse versorgen sollte. Ohne sich an Vorbilder anlehnen zu können, hat Haller ein System der Weidewirtschaft entwickelt, die Hühner- und die Fischzucht eingeführt sowie den Gemüseanbau gefördert, und zwar mit Methoden, die von den Bauern der Küsten-gegend übernommen werden konnten.
Bereits bei der Realisierung dieses ersten Projektes zeigten sich Grundlinien von Hallers Wirken, die fortan leitend blieben. Das Projekt nahm sorgsam Rücksicht auf die ökologischen Aspekte; die Weidewirtschaft wurde so angelegt, dass sie die natürliche Vegetation nicht schädigte. Weiter wurde immer bedacht, dass Gemüseanbau und Viehzucht auch von den einheimischen Bauern nachgeahmt werden konnten; mit sorgsamer Pädagogik wurden sie für die neuen Methoden gewonnen. Indem René D. Haller später das Gemüse der eigenen Produktion von den lokalen Märkten zurückzog, um die einheimischen Bauern nicht zu konkurrenzieren, setzte er ein Zeichen für grosses Verständnis der wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Diese ökologische, pädagogische und ökonomische Sorgfalt bewährte sich später bei jenem grossen Projekt, welches das eigentliche Lebenswerk von René D. Haller geworden ist. In den Jahren 1954 bis 1970 zeigte sich, dass der Kalksteinbruch, aus dem das Zementwerk sich versorgte und der sich immer weiter ausdehnte, eine sehr hässliche Wunde in der Landschaft hinterliess, eine Steinwüste, in welcher nichts mehr wachsen konnte. Man muss es der Leitung der Zementfabrik hoch anrechnen, dass sie ihrem Landwirtschaftsexperten Haller freie Hand liess, um mit einer Wiederbepflanzung zu beginnen. Durch sorgfältige Naturbeobachtung und breit angelegte Versuche gelang es ihm, einen Baum zu finden, der in einer so schwierigen Umwelt gedeihen konnte. Ren6 D. Haller wird selber die komplizierten und vielfältigen Wege und Umwege schildern, die beschritten wurden, um aus der Steinwüste einen Mischwald entstehen zu lassen, in dem eine reiche Tierwelt lebt. Parallel zur Waldentwicklung wurde eine Fisch- und bald auch eine Krokodilzucht aufgebaut, die für das ökologische Gleichgewicht des Pflanzenlebens wichtig wurden.
Seit langem ist das ganze System wirtschaftlich selbsttragend, d.h. es braucht keine finanzielle Beihilfe. Und es wirkt als überzeugender Anschauungsunterricht für Menschen aus der ganzen Welt: Auf der Baobab-Farm werden Bauern und Fischzüchter ausgebildet, ein Lehrpfad im Naturpark weist auf die Zusammenhänge hin und wurde 1990 von 75'000 Menschen, vorwiegend Einheimischen, besucht. Während des ganzen Aufbaus wurden nie chemische Pflanzenschutzprodukte, Kunstdünger und chemotherapeutische Hilfsmittel für die Tierzucht eingesetzt; als ökologischer Pionier hat René D. Haller der Natur ihre Regeln abgelauscht und ihre Mechanismen einzusetzen gelernt.
Es braucht wohl keine weitere Begründung für die Ehrung des diesjährigen Preisträgers. Als Universitätslehrer darf ich mit Freude anerkennen, dass hier ein Mann ohne akademische Ausbildung, ein sogenannter Praktiker, genuin wissenschaftliche Methoden gefunden und angewendet hat. Er hat allerdings viel wissenschaftliche Literatur aufgearbeitet und ist später sogar zum Lehrmeister von jungen Akademikern geworden, die bei ihm an ihren Dissertationen arbeiten. Er ist einer jener «wise men with dirty boots», von denen einer in der Frühzeit der sogenannten Entwicklungshilfe gesprochen hat. Wir ehren in René D. Haller einen Schweizer, der seine Lebensleistung im Ausland erbringt; darin gleicht er Dr. J. E. Brandenberger, nach dem die Stiftung genannt ist. Er gleicht ihm auch darin, dass er ein Erfinder ist, nicht im Labor, sondern in der Natur und im Kontakt mit Menschen, nicht der Erfinder einer Maschine oder einer chemischen Substanz, sondern der Erfinder eines Verfahrens, mit dem man eine Wüste grün machen kann. Es ist also durchaus im Sinne der Stifterin, welche unter den möglichen Preisträgern an erster Stelle Techniker, Chemiker und Physiker nennt, also Menschen, von denen man gemeinhin Erfindungen erwartet.
Nun gibt es neben Erfindungen, die wohltätig und hilfreich sind, allerdings auch solche, die durch ihren Gebrauch schrecklich werden können. Wir wissen in diesem Jahrhundert etwas davon. Was demgegenüber an Ren6 Hallers Er-findung besonders beeindruckt, ist die Umsicht, mit der er die mannigfaltigsten Zusammenhänge und Auswirkungen berücksichtigt hat. Wie bereits gesagt, hat er die Regelkreise der Natur respektiert, ja da und dort für seine Ziele ausgenützt. Zur ökologischen Sorgfalt kommt das bewusste Eingehen auf ökonomische Zusammenhänge; wenn diese nicht beachtet werden, kann die schönste Erfindung kontraproduktiv werden. René Haller hat einen Betrieb mit 400 Angestellten geschaffen, der sich ökonomisch selber trägt und ausserdem grosse Ausbildungsleistungen erbringt. Und endlich fällt das Geschick auf, mit welchem der Erfinder für die Verbreitung seiner neuen Technik gesorgt hat. Dafür ist der Naturlehrpfad das Beispiel. Mit alledem ist Haller eine integrierte Erfindung gelungen, durch die er sich gleichzeitig als Ökologe, Pädagoge und Ökonom erwiesen hat. Die Stiftungsurkunde umschreibt den zu suchenden Preisträger als einen, «der sich unter grösstem Einsatz seiner Person und seiner Möglichkeiten um das Wohl der Menschheit besonders verdient gemacht hat». Diese Umschreibung trifft für den heutigen Preisträger in hohem Masse zu. Die Begegnung mit seinem Werk vermag zu begeistern, wie ich an Menschen beobachtet habe, die in Kenia waren — und auch an mir selber. Hallers Lebensleistung ist darum auch geeignet, junge Schweizerinnen und Schweizer zu ähnlichen Taten anzuregen und ihnen als Vorbild zu dienen. Es gehört sich, dass wir heute auch den Beitrag in Erinnerung rufen, den Christa Haller zum Lebenswerk ihres Mannes geleistet hat. Wir wissen, dass sie es von Anfang an mitgetragen hat und in kritischen Phasen im Stillen mit diplomatischem Geschick manches Hindernis aus dem Wege geräumt hat. Dafür gebührt ihr unser Dank.
Von der Steinwüste zum Paradies
René D. Haller
Eigentlich waren es die afrikanischen Menschen und ihre Art zu leben, die mich von klein auf faszinierten und später dazu bewogen, nach Tanganjika auszuwandern.
Der direkteste Weg dorthin führte damals über die Tropenschule in Basel. Ich belegte Kurse in Tropenagronomie, Ethnologie, Tropenmedizin und vielem mehr, was eine gute Einführung in das spätere Leben in den Tropen war.
Am 18. März 1956 wanderte ich nach Ostafrika aus. Die ersten Jahre verbrachte ich auf einer Kaffeeplantage am Kilimanjaro, lernte die Umgangssprache des Landes, Swahili, und ein paar weitere Bantu-Sprachen, was mir die Möglichkeit gab, mich mit den vielen verschiedenen Stämmen zu verständigen. Meine Ferien verbrachte ich bei einem der Stämme, deren Art zu leben mich am meisten faszinierte. Einmal waren es die Masai, dann die Sonjo, oder die Mangatti, die damals von der europäischen Kultur wenig beeinflusst waren. Mir ging es darum zu lernen, wie man mit der oft recht unbarmherzigen Natur leben und überleben kann. Ihre Landwirtschaftsmethoden waren in vielen Fällen sehr ausgeklügelt und hatten sich für bestimmte Gebiete bestens bewährt. Die Wachagas am Kilimanjaro z.B. betrieben ein hoch entwickeltes Agro-Forest System mit Bewässerung und Erosionsschutz, und ich lernte mit Staunen.
Jahrzehnte später wurde Agro-Forestry zur Modelehre und von den europäischen und amerikanischen Entwicklungsexperten als die Antwort auf Afrikas Nahrungsmittelknappheit verbreitet. So sah und lernte ich damals vieles, was nicht in den konventionellen Agrikulturlehr-büchern zu finden war.
Im März 1959 machte ich mich auf den Weg zur Küste Kenias, um eine neue Stelle anzutreten. Dr. Felix Mandl, der Gründer und damalige Leiter der 1954 gebauten Zementfabrik bei Mombasa, suchte eine Person, die Methoden entwickeln sollte, um das 600 Hektaren grosse Korallenkalksteinvorkommen der Gesellschaft —Hauptrohmaterial für die Zementherstellung —landwirtschaftlich zu nutzen und so die Belegschaft der Fabrik mit Fleisch und frischem Gemüse zu versorgen. Ich hielt mich zwar selber nicht unbedingt für am besten geeignet, nahm aber die Herausforderung gerne an, zumal es bis anhin noch nicht gelungen war, das Korallenbuschgebiet landwirtschaftlich ökonomisch zu nutzen.
Während der Kolonialzeit wurde die Küste entwicklungsmässig eher stiefmütterlich behandelt. Bis auf ein paar Sisal- und Kokosnussplantagen gab es keine Landwirtschaft und Viehzucht in grösserem Stil. Pflügbares Land war recht rar und der zwischen den fossilen Korallensteinen wachsende Busch nahezu undurchdringlich. Da ich nicht auf vorhandenen Erfahrungen aufbauen konnte, mussten neue Methoden entwickelt werden. Über die Jahre erschufen wir ein System, den Küstenbusch zu nutzen, indem wir Ziegen, Haarschafe, Elen- und Oryx-Antilopen darin weiden liessen, ohne die Vegetation zu schädigen. Parallel dazu wurde auch eine Hühnerzucht aufgebaut. Wärme- und krankheitsresistente lokale Hühnerrassen wurden selektiert und mit weissen Leghorn-Rassen erfolgreich gekreuzt. Wir züchteten sie in kleinen Gruppen von bis zu 300 Hennen in Boden-haltung und im Freiland. Das System war so durchgestaltet, dass es von der lokalen Bevölkerung kopiert werden konnte. Regelmässig gab es einen «Tag der offenen Tür» auf unserer Farm. Heute sind Hühner-, Schaf- und Ziegenzucht sowie auch der von uns entwickelte Gemüseanbau bei den Bauern an der Küste eingebürgert. Die Zementproduktion expandierte schnell und somit vergrösserte sich auch der Kalksteinbruch. Es entstand eine hässliche, vegetationslose Wüste in der einst romantisch schönen Küstenlandschaft am Indischen Ozean. Die Direktion der Zementfabrik beschloss, dass etwas unternommen werden müsse, um die wüste Narbe in der Landschaft zu verschönern. Damals wurde Umweltschutz noch kleingeschrieben und es gab keine Auflagen von seiten der Regierung. Der Wille, etwas gegen die Landschaftszerstörung zu tun, war da, doch die Hindernisse für eine erfolgreiche Rehabilitation schienen zu Beginn unüberwindbar. Als für die Ländereien der Gesellschaft Verantwortlicher wurde ich gebeten, etwas zu unternehmen und erhielt damit freie Hand zu experimentieren. Kein Beispiel einer erfolgreichen grossflächigen Kalksteinbruch-Rehabilitation war mir bekannt. Als ich zuerst ratlos die über 150 Hektaren grosse leblose Mondlandschaft durchwanderte, kam ich mir noch kleiner vor. Wohl war der fossile Korallenkalk bis an den Grundwasserspiegel abgetragen, aber die in der Tropensonne glitzernden Kristalle wiesen darauf hin, dass das Wasser hoch salzhaltig war. Und wo sollte der Mutterboden her-kommen, um auf der riesigen Fläche wenigstens ein paar salztolerante Gräser zum Wachsen zu bringen, geschweige denn, Bäume pflanzen zu können? Das Vernünftigste erschien mir, zu versuchen, die Natur nachzuahmen. Ich suchte auf kahlen Sanddünen und in den ältesten Teilen des Steinbruchs nach Pionierpflanzen, die ohne Erde wachsen konnten. Es gab wenige; nebst ein paar Farnen und Gräsern fand ich einen Baum mit nadelähnlichen Zweiglein. Dieser sollte später der Schlüssel zum erfolgreichen neuen Ökosystem werden — doch bis dahin war es noch ein langer Weg. Anfang Januar 1971 liess ich in der Mitte der kahlen Steinbruchfläche ein paar Hundert kleine Löcher in den Korallengrund brechen, füllte sie mit einigen Schaufeln voller eingebrachter Erde und bepflanzte sie mit 26 Baumarten, die ich in verschiedenen Forstgärten entlang der Küste gesammelt hatte. Nach sechs Monaten lebten nur noch 3 der gepflanzten Baumarten. Der erfolgreichste von ihnen war der Baum mit den nadelähnlichen Zweiglein, die Kasuarine. In den nachfolgenden sechs Monaten pflanzte ich 3000 Kasuarinen. Sie wurden zum Nukleus des entstehenden Waldes, und in-zwischen haben wir über 1,5 Millionen Kasuarinen als Pionierbäume im Steinbruch gepflanzt. Der eigentliche Durchbruch kam mit der Entdeckung, dass die Bäume mit Hilfe von Mikrolebewesen alle für ihr Wachstum notwendigen Nährstoffe aus der Luft und aus den Korallenfels, ohne Erde, aufnehmen konnten. Die kontinuierlich fallenden Nadelzweiglein der schnell wachsenden Bäume wurden von einem Tausendfüssler als Nahrung verwendet; sein Kot war der Anfang zum Aufbau von Humus auf dem leblosen Fels. Nun war auch die erste Hoffnung zu einer späteren kommerziellen Nutzung des entstehenden Waldes gegeben.
Der sich aufbauende Humus ermöglichte es, Gräser, Kräuter und Büsche wachsen zu lassen und somit einer Vielzahl von Lebewesen eine Existenz zu bieten. Daraus ergab sich ein Weg aus der anfälligen Monokultur. Um den natürlichen Aufbau des neu entstehenden Ökosystems nicht zu gefährden, war es auch klar, dass man keine Agrochemikalien und Kunstdünger verwenden durfte. Jedes sich zu schnell vermehren-de Lebewesen musste mit einem Konkurrenten oder Fressfeind unter Kontrolle gebracht werden. So wurden z.B. Ratten und Mäuse durch das Einsetzen von Schlangen dezimiert und diese wiederum mit Waranen, Mangusten und Vögeln; Blattläuse und Schmierläuse mit Feuerameisen sowie Marienkäfern und deren Larven; Stechfliegen, die im Kot der eingesetzten Antilopen brüten, werden von Pillendrehern vernichtet; Tsetsefliegen und Zecken werden von Perl-hühnern und anderen Vögeln gefressen. Natürlich müssen die drohenden Gefahren rechtzeitig erkannt werden, um eine Gegenmassnahme zur Hand zu haben. Viele der Pionierbäume sind in-zwischen gefällt worden und haben für neue Pflanzenarten Platz gemacht. Über 180 einheimische Waldbäume gedeihen heute im neuen Mikroklima und dem von den Tausendfüsslern geschaffenen Boden. Ein Küstenmischwald ist im Entstehen, besiedelt von einer grossen Zahl von Schmetterlingen, Insekten, Vögeln und kleinen Antilopen.
Parallel zur Waldentwicklung wurde ein integriertes Aquakultursystem aufgebaut; es besteht aus drei Hauptkomponenten: Fische, Krokodile und Reis. In den Anfängen wurden die Fische in ausgehobenen Grundwasserteichen gezüchtet. Dies war aus verschiedenen Gründen kein wirtschaftlicher Erfolg, führte jedoch zur Entwicklung einer neuartigen intensiven Fischzucht in Zementbecken. Bis anhin wurden Tilapias (Afrika-Buntbarsche) nur in Teichen erfolgreich gezogen. In dem auf der Baobab Farm über die Jahre entwickelten Fischkultursystem war es möglich, in Rundstrombecken aus Beton mit drei Ernten pro Jahr bis zu 100 kg Fisch pro Quadratmeter Wasserfläche zu produzieren. Alle weiteren Entwicklungen in der Aquakultur waren logische Schlussfolgerungen, um die Fischfarm optimal ökologisch und ökonomisch zu nutzen. So dienen z.B. Fische und Fischabfälle, die aus wirtschaftlichen oder hygienischen Gründen ausgeschieden wurden, als Futter für Krokodile.
Das Wasser der Fischfarm fliesst durch die Krokodilaufzuchtbecken, wird mit nitrat- und phosphatreichen Exkrementen angereichert und fliesst von dort in ein Reisfeld, wo viele der Nährstoffe ausfallen und zur Düngung der Reispflanzen dienen. Das aus dem Reisfeld fliessende Wasser wird durch Klärbecken, die mit Wasserpflanzen bestanden sind, geführt und läuft dann gereinigt zurück zur Pumpstelle der Fischfarm. Die Wasserpflanzen (Nil-Salat) aus den Klärbecken werden in der nahen Steinbruch-Bananenplantage als Gründünger verwendet. Im Aquakultursystem wird, wie im Waldsystem, auf jegliche Chemotherapie bei Fischen und Krokodilen verzichtet sowie auch auf Pestizide in den Reisfeldern. Die verschiedenen Komponenten des Kreislaufs werden ständig verbessert, und wir sind dabei, das gesamte Konzept im Detail wissenschaftlich zu bearbeiten. Seit ein paar Jahren ist unser integriertes Ökosystem für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir führen auf der Farm Kurse für Bauern und zukünftige Fischfarmer durch. 1990 zählte unser ehemaliger Steinbruch 75 000 Besucher; 60 Prozent waren Einheimische, meist Studenten und Schüler.
Dank der vielfältigen Vernetzung ist die Steinbruchrehabilitation wirtschaftlich selbsttragend und nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung der Zementfabrik angewiesen. Teile unseres Systems werden in afrikanischen Ländern und anderen Teilen der Welt erfolgreich angewendet. Das Hauptgewicht der Entwicklung liegt in der Schulung der Afrikaner am praktischen Beispiel. Es soll gezeigt werden, dass Umweltschutz und industrieller Fortschritt parallel laufen können und nicht eine andauernde Zer-störung der Natur bedeuten müssen und die Bemühungen sogar einen wirtschaftlichen Sinn machen.